Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Vom Sinn und Unsinn der Geschichte
| ISBN | 3518585398 | |
| Autor | Reinhart Koselleck | |
| Verlag | Suhrkamp | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 388 | |
| Erscheinungsjahr | 2010 | |
| Extras | - |
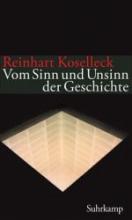
Rezension von
Ragan Tanger
Eine unverzichtbare Sammlung wissenschaftstheoretischer Texte
weitere Rezensionen von Ragan Tanger

Die Sattelzeit ist nicht etwa der Moment, in dem ein Pferd reittauglich gemacht wird, sondern ein besonders bedeutender Begriff der europĂ€ischen Geschichtsschreibung, der die Epochenschwelle zwischen frĂŒher Neuzeit und Moderne zwischen der Mitte des 18. und des 19. Jahrhunderts kennzeichnet. In Anlehnung an die Metapher des Bergsattels schuf Reinhart Koselleck bei seinen umfangreichen Studien zur AufklĂ€rung diesen Begriff, der heute zum guten Ton jedes Historikers und Nachschlagewerks gehört. Nicht nur wegen dieser Institutionalisierung solch zentraler Begriffe wird Koselleck heute als einer der gröĂten Geschichtsschreiber der Nachkriegszeit angesehen. Zahlreiche Ehrendoktorate, Gastprofessuren, Akademiemitgliedschaften und akademische Preise wĂŒrdigten seine Verdienste um die Geisteswissenschaft in Deutschland.
Neben dem Kern historischen Arbeitens, der Quellenanalyse und der Kenntnisse des Hergangs und deren prosaischer Transkription, profilierte sich der 1923 in Görlitz geborene Koselleck als Geschichtsphilosoph und Wissenschaftstheoretiker, also als jemand, der nicht nur Geschichte schreibt, sondern auch darĂŒber sinniert, wie und warum man sie so darstellt, wie es getan wurde und getan wird. Zahlreiche Kollegen der Postmoderne haben schlieĂlich etwas Ăhnliches offengelegt: Geschichte ist eine individuelle und persönlich konstruierte Darstellung, die weder der RealitĂ€t noch der allgemeineren Anschauung entspricht. Dadurch erscheint eine nĂŒchterne und kohĂ€rente Umsetzung dieser ungĂŒnstigen Vorlagen umso notwendiger. Im Rahmen solcher Ăberlegungen veröffentlichte Koselleck Zeit seines Lebens zahlreiche AufsĂ€tze, VortrĂ€ge und Essays, die in diesem Band zusammengestellt, teilweise bislang unveröffentlicht, wurden.
Carsten Dutt, der diese Edition zusammengetragen hat, betont, dass dies im ausdrĂŒcklichen Sinne Kosselecks stand, der den Nachlass nur insofern integrierte, als dass diese Schriften auch zur Veröffentlichung gedacht waren. Die bekanntesten BeitrĂ€ge, nĂ€mlich derjenige der den Titel des Buchs trĂ€gt sowie die Laudatio fĂŒr Werner Conze mit dem Titel âWozu noch Historie?â und die wichtigen Schriften ĂŒber die fiktive Grundlage der Geschichtsschreibung sind natĂŒrlich auch lĂ€ngst in vielerlei anderen Organen veröffentlicht worden, dennoch ist diese kompakte Zusammenstellung jener wichtigsten wissenschaftstheoretischen Texte von Koselleck mehr als zu wĂŒrdigen. Hinzu kommen vier bislang nicht veröffentlichte BeitrĂ€ge, unter anderem ĂŒber das 19. Jahrhundert und eine Gedenkrede fĂŒr Hans-Georg Gadamer.
Blind den Honorationen vertrauen muss man aber nicht, sondern besser lesend mitdenken, verstehen und argumentieren, diskutieren und deputieren, so wie es Koselleck selbst gemacht hat; gerne und ĂŒberfrachtet mit dem akademischen Sprachgebrauch, der auch nur unter seinesgleichen zu lesen ist. Der Otto-Normal-Historiker fĂŒhlt sich bei seiner Masse an Wissen und der fachspezifischen Dialektik schnell vor den Kopf gestoĂen, was schade ist, denn der Inhalt ist reichlich und immer trefflich.
Gerade Koselleck, der sich 1941 freiwillig zur Wehrmacht meldete und erst nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft Geschichte studierte, hat bedeutende Geschichte selbst erlebt und verweist deswegen umso dringlicher auf die Erinnerung, unterstĂŒtzt nachdrĂŒcklich die Fiktion des Faktischen, rĂŒttelt dabei aber nur interepatotrisch an der RealitĂ€t. Da kann man anderer Meinung sein, aber man sollte diese Meinung vorher gelesen haben.
Seine StĂ€rken liegen zweifelsfrei in der Sinnlosigkeit, die wider den Unsinn die Geschichte ausmacht und ihr nichtsdestoweniger immerhin die grundlegende Kraft gibt. Mit diesen Ăberlegungen können alle Studenten und bereits ausgebildete Historiker punkten; so eine Zusammenstellung gehört einfach ins BĂŒcherregal. Anspruchsvolle Fachfremde seien ebenfalls eingeladen, das Oeuvre dieses berĂŒhmten Wissenschaftlers kennenzulernen, es ist, um mit seinen eigenen Worten zu sprechen, eo ipso selbstreferentiell.
geschrieben am 12.07.2010 | 521 Wörter | 3575 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen