Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet
| ISBN | 3932909429 | |
| Autoren | Gerhild Tieger , Thomas de Quincey | |
| Verlag | Autorenhaus Verlag | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 151 | |
| Erscheinungsjahr | 2004 | |
| Extras | - |
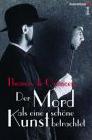
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Darf man einen Mord allein unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachten? Diese Frage war für Thomas de Quincey (1785 – 1859) wie für Dostojewski mit seinem Rodion Raskolnikow nicht die eigentliche. Aber sie wird von den Moralaposteln in den Vordergrund gerückt, weil sie Angst haben. Angst, dass ihr kleines Philisterdasein komplett in Frage gestellt wird. Man geht jeden Tag brav ins Büro, man macht seien Job so gut es eben geht, zahlt seine Steuern, geht artig wählen. Und dann kommt da so ein dahergelaufener Literat und will am Mord Ästhetisches entdecken? Die Aufregung nach der Veröffentlichung von de Quinceys wunderbaren Provokationen vor nunmehr genau 180 Jahren war eine ähnliche wie die nach der von Dostojewskis furiosem Roman Rodion Raskolnikow - Schuld und Sühne: Die amoralische Sichtweise auf das Verbrechen wird einsgemacht mit seiner Rechtfertigung.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

In dem kleinen Band „Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet“ sind drei ironisch-humoristische Erzählungen versammelt, in denen eine amoralische Sichtweise auf den Mord im Zentrum steht. Sie alle wurden zuerst in Magazinen veröffentlicht: Der erste Teil 1827 im Februar-Heft von „Blackwood’s Magazine“, der zweite Teil des Buches, „Über den Mord“, fast dreizehn Jahre später im selben Magazin. Die einzelnen Stücke korrespondieren dabei auch in der Form, dass de Quincey einleitend die über ihn hereingebrochene Welle der harschen Kritik aufnimmt, - um sodann seinen Faden mit neuem provokativem Elan weiter zu spinnen: »Wie sich der geschätzte Leser entsinnen wird, gab ich mich vor einer Reihe von Jahren für einen Mordliebhaber, oder, besser noch, für einen Kunstkenner in Mordsachen aus, wenn das Wort ‚Liebhaber’ dem Geschmack des mit einem zarten Gewissen und schwachen Nerven begabten Publikums zu krass klingen sollte. Darin, hoffe ich, kann niemand etwas Unrechtes finden. Schließlich ist doch kein Mensch verpflichtet, Augen, Ohren und Verstand in die Hosentasche zu stecken, wenn sich ein Mord ereignet. Falls er nicht gänzlich stumpfsinnig ist, muss es ihm unbedingt einleuchten, dass ein Mord mehr oder weniger geschmackvoll ausgeführt werden kann als der andere. Wie Statuen, Gemälde, Oratorien, Kameen und Schnitzwerke, so unterscheiden sich auch Morde durch feine, künstlerische Nuancen.«
Thomas de Quincey hat seinen englischen wit, diese spezielle Art von feinsinnigem, ironischem Humor, für den es bezeichnenderweise gar kein deutsches Wort gibt, sein Leben lang nicht verloren. Grund genug dafür hätte er gehabt. 1785 als Sohn eines Tuchhändlers geboren, der bereits 1793 verstarb, hat er früh die Abgründe des Lebens geschaut. 1802 floh er von seiner Mutter in die Slums von Wales und später London. Hier flüchtete er sich in die englischen Romantiker, die ihn beeinflussen sollten: vor allen anderen Wordsworth und Coleridge. Im Armenviertel Londons lernte er die Prostituierte Ann kennen, was später in sein berühmtestes Werk einfloss: „Confessions of an english opium-eater“ („Bekenntnisse eines englischen Opiumessers“). Auf dem College war er ein Einzelgänger, wie viele Literaten zog er die Gesellschaft von Büchern der von Menschen vor. Wegen eines Nervenleidens begann er 1804 die Einnahme von Opium. In den kommenden Jahren verstärkte sich die Labilität seiner Gesundheit und in deren Folge sein Opiumkonsum. Er wurde abhängig. Er machte ein kleines Erbe, dass er wohl zum größten Teil für Bücher ausgab. Einen Teil schenkte er anonym dem glühend verehrten Coleridge. Sein Studium brach er kurz vor dem Examen ab. 1817 heiratete er die Bauerstochter Margaret Simpson, mit der er acht Kinder bekam. Trotz seiner literarischen Produktivität war de Quincey ein Leben lang verarmt. So musste er 1832 – wenn auch nur für kurze Zeit – ins Schuldengefängnis, im Jahr darauf musste er seinen Bankrott erklären. Nach dem Tod seiner Frau 1837 verstärkte er seinen Opiumkonsum noch weiter. Er starb 1859 in Edinburgh.
Bereits in der von ihm herausgegebenen „Westmorland Gazette“ berichtete de Quncey 1818 über Mordprozesse. So lag es für den der Sprache mit all ihren Facetten der Ironie Mächtigen nur nahe, dies zu eher essayistischer Form zu verdichten. Im ersten Stück, „Die Vorlesung“, lässt er in der ersten Person eine Vorlesung über die Kunst des ästhetischen Mordens halten. Diese gipfelt darin, dass der Dozierende »ein paar Regeln für den Mord, nicht als Anweisung für Ihre Praxis, sondern als Anleitung für Ihr Urteil« gibt. So sei wichtig, dass der zum Mordopfer Erkorene ein guter Mensch sein müsse, sonst hege er vielleicht selbst Mordabsichten, und Konkurrenz wäre hier unschicklich. Das Opfer solle keine in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeit sein, denn diese wäre für die Masse nur ein Abstraktum, ohne ihm je begegnet zu sein. Weiter dürfe das Opfer weder alt noch krank sein. Zur Mordkunst gehöre, dass das Opfer dem Mörder körperlich gewachsen sein müsse. Das zweite Stück „Über den Mord“ schildert das fiktive Festmahl eines Clubs, bei dem über die Bedingungen für einen gelungenen Mord debattiert wird. Und gelungen ist nach den Club-Grundsätzen ein Mord nicht etwa dann, wenn der Mörder nicht gefangen wird, als vielmehr wenn er ästhetischen Ansprüchen genügt. Das dritte Stück des Büchleins ist eine „Nachschrift“, die de Quincey zu der Veröffentlichung der anderen beiden Essays in seinen „Gesammelten Werken“ hinzufügte. Es handelt sich um einen anspruchsvollen und spannenden Dokumentarbericht über die sogenannten Ratcliffe-Morde, die im Dezember 1812 von einem John Williams begangen worden waren. In der Detailfreudigkeit der Schilderung von Tatverlauf und Persönlichkeit des Täters dient der Bericht heute als Lehrbeispiel: ein Grundmuster für eine authentische Kriminalerzählung.
Dem Berliner Autorenhaus Verlag ist zu verdanken, dass de Quinceys tief schwarze Satiren in der Übertragung von Alfred Peuker nun wieder zugänglich sind.
geschrieben am 03.04.2007 | 882 Wörter | 5128 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen