Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Das Ende des Professors Tschesnokow
| ISBN | 3868053425 | |
| Autor | Igor Schestkow | |
| Verlag | BoD - Books on Demand GmbH | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 393 | |
| Erscheinungsjahr | 2009 | |
| Extras | - |
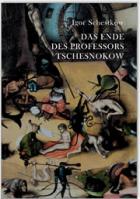
Rezension von
Koch
In Deutschland existiert eine unbekannte literarische Subkultur jĂŒdischer Immigranten aus der ehemaligen UdSSR. Es handelt sich hierbei um zahlreiche Schriftsteller, Dichter und Kritiker. Doch selbst eingefleischte deutsche Literaturkenner finden kaum Zugang zu dieser Literatur. Denn die Werke erscheinen auf Russisch, meist in russisch-sprachigen Zeitschriften und Zeitungen. Ein engagiertes Mitglied des Verbandes russischer Schriftsteller in Deutschland Igor Schestkow, der im Alter von 34 Jahren als jĂŒdischer FlĂŒchtling aus der UdSSR nach Deutschland kam, bietet nun mit seinem ersten deutschen Prosaband einen Beitrag aus dieser verborgenen Literaturszene an.
weitere Rezensionen von Koch

Seine 34 ErzĂ€hlungen basieren auf wahren Begebenheiten. Schestkow lenkt in ihnen den Blick auf die Zeit seiner Moskauer Kindheit bis zu seiner Ausreise 1990. Die Texte gewĂ€hren Einblicke in die menschliche Psyche einerseits und in soziale und politische MissstĂ€nde andererseits. Sie fixieren Resultate von langjĂ€hriger in der sowjetischen Gesellschaft durchgefĂŒhrter negativer Selektion, öffentlicher LĂŒge und vom langjĂ€hrigen Staatsterror. âDas Ende des Professors Tschesnokowâ ist kein analytisches oder historisches Buch, sondern eine Ă€uĂerst subjektive Skizze des Schriftstellers, der sich selbst und seine Zeitgenossen verstehen will.
Die Sprache ist klar und ohne TrĂŒbstoffe, fĂŒhrt ohne Umschweife zum Fokus der ErzĂ€hlungen. Meistens ist sie nĂŒchtern drastisch, manchmal reportageartig oder sinnlich. Im Extremfall wirkt sie surreal, wenn Innen- und AuĂenwelt verschwimmen und sich die Handlung nur durch die absurde Logik des Albtraums fassen lĂ€sst.
Das Buch 393 Seiten und kostet im Buchhandel 15 Euro. Die Leser mit Interesse an russischer Literatur und an dem groĂen Experiment UdSSR und seinen Folgen in den menschlichen Schicksalen werden dieses ernsthafte Buch mit Gewinn lesen.
geschrieben am 06.04.2009 | 253 Wörter | 1630 Zeichen
Rezension von
Schlott
Der seit 1990 in Deutschland lebende Schriftsteller und Kunsthistoriker, seit Beginn des 21. Jahrhunderts mit mehreren russischsprachigen ErzĂ€hlbĂ€nden auf dem deutschen und russischen Markt vertreten, legt mit diesem Prosaband seine erste deutschsprachige Veröffentlichung vor. Nach seiner Meinung versucht er ânicht nur die sowjetischen Menschen, sondern ĂŒberhaupt Menschen zu verstehen: ihr inneres Chaos, ihre absurden Motivationen und ihr tragisches Schicksal.â (Klappentext)
weitere Rezensionen von Schlott

In den hier vorliegenden ErzĂ€hlungen treten Protagonisten auf, die sowohl aus einer Ich-Perspektive ihre RealitĂ€t beobachten und werten, als auch eine konsequente auktoriale ErzĂ€hlerhaltung einnehmen. Beide narrative Haltungen bemĂŒhen sich um die Beschreibung von konfliktgeladenen Ereignissen und Erlebnissen, die den sowjetischen Alltag der 1970er und 1980er Jahre geprĂ€gt haben. AuffĂ€llig ist, dass sich hinter der Maske des Ich-ErzĂ€hlers oft ein pubertierender Jugendlicher verbirgt, der seine Abscheu und sein Erstaunen ĂŒber das Verhalten der Erwachsenen zum Ausdruck bringt, der sich auch in die Erlebniswelt seiner Bekannten und Freunde versetzt. Das Ergebnis dieser âInkarnationenâ ist eine wachsende Distanz gegenĂŒber pathologischen Merkmalen seiner Umwelt. In der TitelerzĂ€hlung ist es ein gewisser Iwan Sysojewitsch Tschesnokow, ein eingefleischter Alt-Stalinist, der sich gegen jegliche Reformen wendet, die Perestrojka fĂŒr unsinnig hĂ€lt, seine Familie tyrannisiert, sich seinen egozentrischen Wahnvorstellungen hingibt und von schrecklichen Monstern im Traum zerfleischt wird. Dieses ĂŒbel riechende Monster (tschesnok = Knoblauch), das den Vatersnamen Sysojewitsch trĂ€gt und damit auf den in den 1970er Jahren im sowjetischen Untergrund tĂ€tigen Karikaturisten Sysojew verweist, der schreckliche Betonköpfe als Abbild von Diktaturen zeichnete, erweist sich als abschreckende Inkarnation eines verbrecherischen Systems, das der auch in andere Personen schlĂŒpfende ErzĂ€hler verabscheut. Egal, wer sich hinter diesen Masken verbirgt, KGB-Karierristen, unglĂŒckliche Ehefrauen, die sich an ihren Partnern rĂ€chen, indem sie sich Liebhaber halten, feige Staatsbeamte, die sich auf Kosten von kleinen Angestellten bereichern, ihre pathologischen Handlungsweisen werden mit schonungsloser Offenheit prĂ€sentiert. Ihre Ausdrucksweise greift den Slang der Umgangssprache auf. Sie ist voller Vulgarismen, die den Mat (Mutterfluch-Jargon) der SowjetĂ€ra widerspiegeln.
Auch aus der Perspektive des auktorialen und personalen ErzĂ€hlers gelingen dem Autor eine Reihe von deftigen ErzĂ€hlskizzen, wie zum Beispiel âKolja und Petjaâ. Zwei sich prĂŒgelnde Rotznasen, die ihre von den Erwachsenen erfahrene BrutalitĂ€t und AggressivitĂ€t auf ihre Alltagsbeziehung ĂŒbertragen. Ihre Sprechhandlung ist angereichert mit vulgĂ€ren Ausdrucksformen, ihre körperlichen Gesten zeichnen den Frust ĂŒber ihren langweiligen Alltag nach, ihre Aussagen ĂŒber die sowjetische Schule symptomatisch fĂŒr geistige UnterdrĂŒckung. Sie widerspiegelt sich ĂŒbrigens in allen Prosaskizzen des ErzĂ€hlbandes wider. Somit hinterlĂ€sst die LektĂŒre der 34 Texte eine Horrorvision, die der Einband mit einem Bildausschnitt aus Hieronimus Boschs âDas jĂŒngste Gerichtâ, entstanden um das Jahr 1500, vermitteln soll. Der fehlende Bildnachweis ist an dieser Stell ebenso kritisch anzumerken wie auch eine Reihe von stilistischen Fehlern. Zumindest die zweite Anmerkung schmĂ€lert in keiner Weise den Erkenntnisgewinn nach dem Einblick in die alltĂ€glichen Schrecken in einem Staat, dem der Autor noch vor dem Umbruch von 1991 entfliehen konnte.
geschrieben am 04.07.2009 | 464 Wörter | 3168 Zeichen
Rezension von
Saalmann
Ein Buch zum Hinschleudern und Wiederaufheben
weitere Rezensionen von Saalmann

Gedanken zu einer LektĂŒre
Knapp 400 Seiten. Wochen fĂŒrs Lesen. Einfach, weil es mal wirklich fast ausschlieĂlich Texte enthĂ€lt, von denen sonst die Werbung behauptet: Nur fĂŒr starke Nerven.
In Igor Schestkows Geschichtensammlung: âDas Ende des Professors Tschesnokowâ finden âNervenâ bzw. âGemĂŒtâ bzw. âgesunderâ Verstand keinen Augenblick ein Verschnaufpause, und das ist nicht nur der abrupten, erschreckenden, oft gehetzt wirkenden, aber an jeder Stelle auf den Leser einwirkenden Sprache geschuldet. Nicht nur. Jede der ĂŒber 30 Episoden fĂŒhrt uns in einen anderen schmutzigen Winkel der versunkenen Sowjetunion, auf die der Rezensent (und Ăbersetzer eines der Texte) so groĂe StĂŒcke hielt.
Wir wussten es ja eigentlich: Bei jeder Gelegenheit kreiste die Wodkaflasche, Arbeiter, Verwaltungsangestellte, Offiziere, Sergeanten und Soldaten, âParteiarbeiterâ, ein spĂ€terer PrĂ€sident, selbst groĂe und berĂŒhmte Schriftsteller erwiesen sich als QuartalssĂ€ufer, die AusnĂŒchterungszelle auf der Miliz war ein dem mĂ€nnlichen Teil der Bevölkerung wohlbekannter Ort, wir wussten von der Enge in den âKommunalkiâ, den kommunalen Wohnungen, den VerspĂ€tungen auf Bahnhöfen und FlughĂ€fen trieben dem ungewarnten Reisenden die Haare zu Berge, âBeziehungenâ waren das halbe Leben; im Bauwesen, in der âvaterlĂ€ndischenâ Produktion wurde geschlampt unterschlagen, verschoben und geklaut, SchlĂ€gereien waren allnĂ€chtliche Gewohnheit, schwerste Ăbergriffe in der Armee, der Zustand der öffentlichen ScheiĂhĂ€user (welches Wort sonst?) â usw, usw. Oje.
Ja freilich, aber sie funktionierte ja irgendwie, die glorreiche UdSSR, von Moskau bis zu den fernsten Grenzen, von den sĂŒdlichen Gebirgen bis zu den nördlichen Meeren, wie es im Lied hieĂ, sie hatte nach BĂŒrgerkrieg, faschistischer VerwĂŒstung und endlichem Sieg in rauchenden TrĂŒmmern gelegen, immer vital genug, um die stalinschen âRepressionenâ zu ĂŒberwinden, ihre wiedererstandenen StĂ€dte pulsierten, ihre Basare quollen ĂŒber von FrĂŒchten, keiner hungerte, Kinder lebten nicht in der Kanalisation, man wusste zu leben, (zu feiern), kniff das Papyrossy-MundstĂŒck mit den (Gold-)ZĂ€hnen flach und machte erst mal Perekur, Rauchpause.
Das alles nun ist das weite Feld von Schestkows Geschichten. Die Betonung, die Ăberbetonung liegt jedoch allemal auf den Schattenseiten des Daseins, er sucht, wie gesagt, die stinkenden SchauplĂ€tze des Riesenlandes auf. Er, der Autor, ist persönlich betroffen, selbst ein Emigrant aus jenem Leben, hat es angewidert von sich geworfen, wer sonst, wenn nicht er, wĂŒsste Bescheid?
Und doch hĂ€lt der Rezensent, ein studierter DDR-BĂŒrger, es kaum aus, solche Berichte zu lesen, Trauer ĂŒber das Scheitern der groĂen gesellschaftlichen Vision kommt zum hundertsten Mal wieder hoch, keineswegs HĂ€me, er nickt zustimmend, unter TrĂ€nen.
In den meisten Geschichten ist das erzĂ€hlerische Subjekt ein gewisser Mischa, nebenberuflich Ikonenmaler, hauptberuflich wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem nicht nĂ€her bezeichneten Institut, das irgendwie mit RĂŒstung und Weltraum zu tun hat. Selbst hier â Schlamperei, Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch und Inkompetenz bei der von der Partei eingesetzten Leitung; auf der âunteren Ebeneâ gebildete, fĂ€hige, aber naive Ingenieure und Techniker, Intelligenz, die sich einbringt, aufreibt â und scheitert. Ăberall: Denunziation, Karieredenken, trĂŒber Sex. Das Afghanistan-Trauma. Und immer wieder kreisen die Gedanken um die fĂŒr jĂŒdische MitbĂŒrger immerhin mögliche Ausreise aus dem ungeliebten Sowjet-Staat.
Was drĂ€ngt sich nach immer wieder unterbrochener, erneut aufgenommener LektĂŒre sonst noch ins GedĂ€chtnis: Der unterschwellige Antisemitismus, ein oft zerstörerischer Selbsthass, Dutzende schockierender Alltagsepisoden, an Exhibitionismus reichende Erotik, Mord und Tod. Ekel gelegentlich.
Und dann immer wieder das Entschweben der Phantasie in eine nicht mehr zu fassende, sozusagen kosmische SurrealitĂ€t. Man denkt zugleich an Bulgakow, Nabokow, manchmal an Hemmingway, an den âdirty old manâ Charles Bukowski, ja, und gleichzeitig an Fasil Iskander und an den âneuenâ Ukrainer Andrej Kurkow. Und man denkt auch zurĂŒck an Wassilij Schukschin, der in allem verwandt und doch ein GegenstĂŒck zu Schestkow ist: Auch bei ihm gibt es schlimmen gesellschaftlichen Unflat, böse Geschichten. Die aber doch durchsonnt sind von Sympathie fĂŒr Leute und Land. Bei Schestkow auch: Liebe. Aber Hassliebe.
Die Sprache ist bildreich und drastisch, in manchen Geschichten leider oft unzulĂ€nglich ĂŒbersetzt. Zwar, der etwas Russisch-Kundige freut sich, denn an vielen Stellen entdeckt er im deutschen Text die 1:1 Entsprechung der Ausgangssprache, allzu wörtlich ĂŒbersetzte Wörter und Wendungen.
Zum Schluss hier eine Textpassage, die in Variationen beharrlich wiederkehrt und den Grundton des Buches ausmacht:
âIch wollte ihn nicht hören. Alles, was er sagte, war mir seit langem bekannt. Diese Kenntnis beflĂŒgelte mich nicht, sie bedrĂŒckte mich. Weil ich kein Held war. Ich hasste das âverfluchte Russlandâ auch dafĂŒr, dass es mir stĂ€ndig meine Feigheit demonstrierte. Dieser Staat zwang mich, nach seinen Regeln zu spielen. Niemals lieĂ er mich in Ruhe. Er war allgegenwĂ€rtig. Beherrschte das Bewusstsein. Es war schrecklich, diese widernatĂŒrliche Verbindung des Menschen mit dem Staat. Nicht wir lebten in ihm. Er lebte in uns. Wie ein dominierender Parasit. Ich hatte MitgefĂŒhl mit den Dissidenten, aber zur Selbstaufopferung war ich nicht fĂ€hig. Das Einzige, was ich dem allmĂ€chtigen kommunistischen System entgegensetzen konnte, war meine Kunst und die böse Zunge. Meine Kunst war aber nicht gefragt. Die Moskauer KĂŒchengesprĂ€che bedrĂŒckten mich. Manchmal weinte ich in der Nacht. Vor Hilflosigkeit.â
Dem ist nicht zu widersprechen. Leider.
geschrieben am 09.07.2009 | 807 Wörter | 5129 Zeichen
Rezension von
Lauer
Horrorfilm Glasnost
weitere Rezensionen von Lauer

Igor Schestkows bissige Blicke auf Russland
Die achtziger Jahre brachten der Sowjetunion den Wechsel von Breschnjews Stillstand zu Gorbatschows Perestrojka und endlich den Zerfall der Union. In der westlichen Welt kam eine Begeisterung für "Gorbi" und seine Reformen auf, die mit dem Obama-Kult dieser Jahre vergleichbar ist. Wie wenig die tatsĂ€chlichen sowjetischen VerhĂ€ltnisse den damaligen Illusionen entsprachen, versucht der russisch-jüdische Autor Igor Schestkow in seinem ErzĂ€hlband aufzuzeigen. In vierunddreiĂig pointierten Kurzgeschichten führt er den Leser in eine Welt, in der niedriges menschliches Handeln, grobes Fluchen, krasser Sexismus und Alkoholexzesse an der Tagesordnung sind.
Meist sind die Texte zweiteilig komponiert und warten mit ĂŒberraschenden Wendungen auf. Der Autor, der die Ich-ErzĂ€hlung bevorzugt, zeigt die beengten, bedrĂŒckenden WohnverhĂ€ltnisse und schreckt nicht vor drastischen Schilderungen von TierquĂ€lerei, Homo- und PĂ€dophilie oder sogar Kannibalismus zurück. Oft wendet er die ErzĂ€hlungen ins Surreale und Phantastische, oder er bringt ein Motiv, etwa die Begegnung mit einem tollwütigen Wolf, in drei Varianten â als Kind, als Jugendlicher und in Afghanistan. Vieles hat wohl einen autobiographischen Hintergrund: Kinderstreiche, pubertĂ€re Erregungen, Erlebnisse in Moskau und im Kaukasus, ja der eigene Tod: Er erlebt, wie er erst in einen Schmetterling, dann in eine Silbertaube verwandelt wird und auf den Mond fliegt, wo er sich in einer Spalte zwischen grauen Felsen verbirgt.
Schestkow, 1956 in Moskau geboren, seit 1990 in Deutschland lebend, war hier bisher als Kunstschriftsteller bekannt. Seine grellen, ausschweifenden Geschichten sind nichts für feinsinnige Gemüter; den abgebrühten Leser freilich dĂŒrften sie nicht zuletzt auch wegen ihrer stilistischen Brillanz faszinieren.
Der Klappentext warnt: "Schestkow wendet sich in seiner Prosa nur an den erwachsenen Leser."
geschrieben am 24.07.2009 | 266 Wörter | 1744 Zeichen
Rezension von
MZ
Einblicke ins bigotte Sowietsystem
weitere Rezensionen von MZ

Es gibt in Deutschland eine kaum bekannte Subkultur jĂŒdischer Immigranten aus der ehemaligen Sowjetunion. Dazu gehört der Schriftsteller und Fotograf Igor Schestkow, der nach seiner Ausreise 1990 auch einige Zeit in Chemnitz lebte. Mit dem ErzĂ€hlungsband "Das Ende des Professors Tschesnokow" hat er jetzt eine umfangreiche Zwischenbilanz seines literarischen Schaffens vorgelegt.
Das Buch gleicht einem ReisefĂŒhrer in die alte Sowjetunion, ihre BĂŒrokratie, ihren UnterdrĂŒckungsapparat und ihre Literatur. Es ist ĂŒberreich an Metaphern, Fantasiefiguren, Geistern aus noch gar nicht lange verstaubten Kisten, die die Zensoren einst sicher vor Probleme gestellt hĂ€tten und manchen "gelernten DDR-BĂŒrger" an die trickreichen VerschlĂŒsselungen hiesiger Literatur erinnern werden.
Dies ist ein Vorzug und ein Nachteil des Buches zugleich. Manchmal tragen die skurrilen KostĂŒme, in die der Autor seine Protagonisten steckt, auch heute noch, erinnern an die bizarren, dadaistischen Alltagsbeobachtungen eines Daniil Charms oder den fantastischen Realismus Michail Bulgakows. Manchmal aber wird die eigentliche Geschichte auch unter den Wassermassen samt Meeresungeheuern - wie in der Titelgeschichte - im wahrsten Sinne des Wortes begraben. Einer der besten Texte ist die von dem Chemnitzer GĂŒnter Saalmann ĂŒbersetzte ErzĂ€hlung "TollwĂŒtiger Wolf", die auf besonders drastische Weise die Bigotterie zu Sowjetzeiten schildert.
geschrieben am 04.09.2009 | 193 Wörter | 1273 Zeichen









Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen