Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Das Okkulte: Eine Erfolgsgeschichte im Schatten der Aufklärung
| ISBN | 3886808882 | |
| Autor | Sabine Doering-Manteuffel | |
| Verlag | Siedler | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 352 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
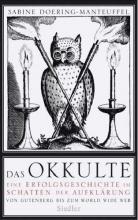
Rezension von
Nicolai Hannig
Als im März 1903 mit Anna Rothe das so genannte „Blumenmedium“ vor Gericht stand, galt es nicht nur, eine Hochstaplerin zu verurteilen, sondern ebenso einen Geisterglauben, der das zeitgenössisch-christliche Selbstverständnis hintertrieb. Zahlreiche „Kunden“, die den spiritistischen Sitzungen der Geisterbeschwörerin, in denen sie meist Blumen vom Himmel regnen ließ, beigewohnt hatten, waren auch vor Gericht anwesend und wurden angesichts der abenteuerlichen Scharlatanerien, die in der Verhandlung ans Tageslicht traten, unfreiwillig zum Gespött der Berliner Öffentlichkeit. Zudem gehörten sie weitgehend höheren Gesellschaftsschichten an, wodurch sich die Belustigung noch steigerte.
weitere Rezensionen von Nicolai Hannig

Ereignisse wie diese waren um die Jahrhundertwende keine Seltenheit, auch war es nicht ungewöhnlich, dass gerade bürgerliche Schichten anfällig für Okkultismus und Spiritismus waren. Denn das Publikum des Okkulten war vor allem ein Massenpublikum.
In ihrer Studie über „Das Okkulte“ geht Sabine Doering-Manteuffel diesem Massenphänomen auf den Grund. Die Augsburger Ethnologin wählt dafür einen Zugriff, der den Okkultismus als Medienprodukt in den Vordergrund rückt und dessen Gestalt vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart aufzuspüren versucht. Gegenstand ist dabei all das, was sich außerhalb der anerkannten wissenschaftlichen, theologisch-religiösen oder staatlichen Wissensformationen bewegte und zu massemedialer Verbreitung gelangte.
Das Okkulte war demnach nicht zwangsläufig – wie der Wortsinn vielleicht nahe legt – ein Phänomen des ‚Verborgenen’, sondern oftmals ein Konstrukt der Medienöffentlichkeit. Innovationen in der Medientechnik angefangen beim Buchdruck bis hin zum World Wide Web beförderten laut Doering-Manteuffel nämlich nicht nur die Alphabetisierung und allgemeine Rationalisierung. Vielmehr schürten sie den Aberglauben ebenso wie sie ihn verdrängten.
Deutlich wird in der Analyse eines mit etwa 500 Jahren relativ breiten Zeitrahmens das allmähliche Übergleiten des mittelalterlichen Aberglaubens in den neuzeitlichen Unterhaltungssektor, in dem seit etwa 1900 das Okkulte vor allem in Formen von Verschwörungstheorien und naturwissenschaftlich aufgeladenen Kosmologien beim Publikum reüssierte. Bekannteste Beispiele hierfür sind sicherlich Hanns Hörbigers Welteislehre und die Theorien des methodischen Holisten Edgar Dacqué, die Doering-Manteuffel in ihren Analysen in den Vordergrund rückt. Parallelen dazu sieht die Verfasserin besonders in den Theorien Erich von Dänikens, der in seinen Werken immer wieder die urzeitliche Veredelung der Hominiden durch Außerirdische zu belegen und damit ähnlich wie Dacqué die naturwissenschaftliche Abstammungslehre zu falsifizieren versuchte.
Ihre Stärken findet Doering-Manteuffels Mediengeschichte des Okkulten immer dann, wenn sie Verbindungen und Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Zeitperioden aufweisen und deuten kann. So zeigt sie neben den frappierenden Übereinstimmungen zwischen von Dänikens Ufologien und den Holismen des frühen 20. Jahrhunderts auch Verbindungen zwischen den in den 1970er Jahren in England breit diskutierten Kornkreisen und „Mähteufel- und Feen-Mythologien“ aus dem 17. und 18. Jahrhundert auf. Ebenfalls gelungen sind die vielen Einzelbeispiele und kurzweiligen Intermezzos, die von Teufels- oder Kobolderscheinungen, Séancen und anderen unerklärlichen Phänomene erzählen und von der Autorin geschickt in übergeordnete Kontexte eingeordnet werden. Störend bleibt allein der gelegentliche Hang zum Desavouieren und Entlarven, der vor Alchemisten, Geisterbeschwörern und Ufologen ebenso wenig halt macht wie vor der Selbstreferenzialität des World Wide Web und dem Internet-Lexikon Wikipedia, der „elektronischen Enzyklopädie mit Jenseitsanschluss“.
geschrieben am 16.08.2008 | 477 Wörter | 3359 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen