Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Endzeit Europa
| ISBN | ||
| Autor | Peter Walther | |
| Verlag | Wallstein Verlag | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 432 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
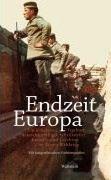
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
┬╗Wir hatten H├Ârs├Ąle, Schulb├Ąnke und Werktische verlassen und waren in den kurzen Ausbildungswochen zu einem gro├čen, begeisterten K├Ârper zusammengeschmolzen┬ź, beschreibt Ernst J├╝nger auf der ersten Seite seines wohl ber├╝hmtesten Buches die Stimmung, die 1914 Deutschland erfasst hatte. ┬╗Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit┬ź, schreibt er weiter, ┬╗f├╝hlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungew├Âhnlichen, nach der gro├čen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg mu├čte es uns ja bringen, das Gro├če, Starke, Feierliche. Er schien uns m├Ąnnliche Tat, ein fr├Âhliches Sch├╝tzengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen.┬ź
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

J├╝nger schuf mit ┬╗In Stahlgewittern┬ź das wohl bekannteste Buch zum Ersten Weltkrieg neben Erich Maria Remarques ┬╗Im Westen nichts Neues┬ź. Es basiert auf den kleinen Tagebuchkladden, die J├╝nger stets mit sich f├╝hrte und in die er das Erlebte notierte. Das aus diesen Aufzeichnungen Extrahierte, das sp├Ątere Buch, ist jedoch eine Stilisierung. Denn vergleicht man diese Aufzeichnungen, die mittlerweile im Marbacher Literaturarchiv liegen, mit dem ver├Âffentlichten Text, so stellt man fest, dass J├╝nger sich und sein Handeln massiv heroisierte. In seinen authentischen Aufzeichnungen liest man n├Ąmlich: ┬╗Wann hat dieser Schei├čkrieg eine Ende?┬ź
Dieser Satz findet sich nun in ein einem gro├čartigen Begleitband einer gro├čartigen Ausstellung wieder. ┬╗Endzeit Europa┬ź, hei├čen Buch und Ausstellung. Die Schau der Zitate wird am 11. November 2008 im Kurt Tucholsky Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg er├Âffnet. Sie wandert dann anschlie├čend nach Potsdam, Finsterwalde, Erkner, und Oranienburg. Dadurch wird die Ausstellung bis Mitte Januar 2010 in Brandenburg zu sehen sein.
Pr├Ąsentiert werden Texte von ├╝ber 100 deutschen und franz├Âsischen Schriftstellern, Intellektuellen und K├╝nstlern, die eben nicht zur Ver├Âffentlichung bestimmt waren. Es ist sozusagen die private, die pers├Ânliche Sichtweise. Sie ist h├Ąufig intimer, sensibilisierter und weniger gestylt als das, was derselbe Autor ver├Âffentlicht hat. Sie ist authentischer und vielleicht ehrlicher. Ein weiteres Plus ist die gro├če Anzahl von Autoren und Zitaten, die tats├Ąchlich, wie die Ausstellungsbeschreibung formuliert, eine Art kollektives Tagebuch entstehen l├Ąsst. So ist es nur stimmig, dass man Walter Kempowski um ein Geleitwort gebeten hat. ┬╗Mehr als die unz├Ąhligen Pamphlete, Aufrufe und Gegenaufrufe [ÔÇŽ] geben die privaten Briefe und Tageb├╝cher preis, wie die deutschsprachigen Schriftsteller und K├╝nstler die Zeit erlebten, was sie ├╝ber Kriegsverlauf und Kriegsschuld, ├╝ber Niederlage und Revolution dachten.┬ź Schade, dass Kempowski die Ausstellung selbst nicht mehr erlebt. Die F├╝lle des Materials ist es, die eine Collage schafft und damit soetwas wie einen geistigen Begleittext zum damaligen Kriegsgeschehen, der europ├Ąischen Geist haucht.
Ausstellung und Begleitband werden ├Ąsthetisch-kongenial erg├Ąnzt durch zeitgen├Âssische Farbphotografien. Sie stammen zum einen vom Stuttgarter Photographen Hans Hildenbrand, der auf deutscher Seite die einzigen Farbaufnahmen von der Front schuf. Sie erscheinen zum ersten Mal gesammelt im Buch. Der andere Teil der Farbphotos ist vom Franzosen Jules Gervais-Courtellemont. Er ist der einzige Photograph, der auf der Seite der Mittelm├Ąchte Farbaufnahmen vom Kriegsgeschehen machte. St├Ąrker als bisher bekannte Schwarz-Wei├č-Aufnahmen lassen sie die Bestialit├Ąt und den H├Âllencharakter dieses Stellungskrieges anschaulich werden.
┬╗Ich habe mich verheiratet┬ź, berichtet Klabund in einem Brief an Walter Heinrich-Unus vom 30. Juni 1918 und schw├Ąrmt von seiner neuen Frau. Jedoch: ┬╗Was von drau├čen, von der Welt, hereinfliegt, ist mi├čt├Ânig und ├╝bellaut. Die praktische Vernunft ÔÇô wo ist sie hin?┬ź Diese Frage wird vielfach auch heute wieder gestellt. Anlass genug, zu studieren, wie Intellektuelle und K├╝nstler in einer vorhergehenden weltweiten Umruchszeit mit dieser umgegangen sind.
Ausstellung und Begleitband dieses kulturellen Highlights in Brandenburg seien m├Âglichst viele Besucher und Leser gew├╝nscht.
geschrieben am 06.11.2008 | 572 Wörter | 3671 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergńnzungen