Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Merkur 712/713. Neugier. Vom europäischen Denken
| ISBN | ||
| Herausgeber | Karl Heinz Bohrer , Kurt Scheel | |
| Verlag | Klett-Cotta | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 234 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
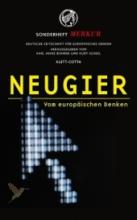
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Symbolträchtig endet die Doppelnummer vom »Merkur« des Jahres 2008 zum Thema »Neugier: Vom europäischen Denken« mit einer Anzeige für Ernst Jüngers Buch »Annäherungen«. Gibt es ein europäisches Buch des vergangenen halben Jahrhunderts, das besser zum Neugierigsein auffordert? Jünger beschreibt in diesem großangelegten Essay nicht nur Grundzüge von Kulturen der Welt. Sich selbst demaskierend, offenbart er seine lebenslange Neugier. Die permanente Suche nach Schock und Gefahr, weil nur über sie - quasi durch sie als medialem Zwischenzustand hindurch - eine Erweiterung von Erfahrungsschatz und Seele gelingen könne. Das ging bei dem Dandyschriftsteller im Kugelhagel des Ersten Weltkrieges, wo seine Tapferkeit nichts anders war als – schiere Todessehnsucht. Bereits ein Jahr zuvor war er neugierig auf ein Abenteuer in Afrika – und floh von der Schulbank zur Fremdenlegion. Später in seinem Leben: mutige Bücher, das Kennenlernenwollen fremder Bräuche und Kulturen. Sinnerweiterung kann erfahren werden in einer Bibliothek, mittels Drogen oder auch durch das Erotische.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Die Herausgeber Karl Heinz Bohrer und Kurt Scheel sehen entgegen der europäischen Tradition heute mehr Fortschritts-Skepsis denn –Euphorie. »Bewahren lautet das Motto, Veränderung wird mehr und mehr als bloßes Risiko wahrgenommen: Gerade die einstigen Verfechter des Neuen und des Fortschritts, die Linken, gebärden sich als die wahren Konservativen«, schreiben sie in ihrem Geleitwort. So soll das Heft verstanden werden als ein Plädoyer für die Kapazität der Neugier unter der Voraussetzung, »dass es sich um ein gemischtes, ja dialektisches Prinzip handelt. Das Alte bleibt immer präsent, die Sehnsucht nach ihm ist geradezu die Bedingung des Neuen in der Moderne«. Daher lösen sich auch nun die politischen Parteigrenzen auf. Was ist heute links, was rechts? Wer bewahrt was. Schließlich: Was gilt, bewahrt zu werden?
Die Herausgeber haben auch für diese – alljährliche – Schwerpunkt-Nummer ihrer »Zeitschrift für europäisches Denken« zwei Dutzend Autoren zusammengetrommelt, die wissen wovon sie schreiben. Volker Gerhardt führt ein mit einer »Kleinen Apologie des Neuen«. Erst in der jeweiligen Zukunft, schreibt Gerhardt, wenn die Gegenwart alt geworden sei, werde sich zeigen, welche Neuerung tragfähig ist. »Wie weit sie jedoch wirklich trägt, wird immer offen bleiben. Deshalb steht alles Neue unter dem Vorbehalt einer ungewissen Zukunft.«
Norbert Bolz, der Medien-Dandy der Berliner Republik, steuert wiederum einen höchst intelligenten und lesenswerten Aufsatz bei über die Legitimität der Innovation. Bolz gibt zu überlegen, ob es nicht angemessener sei, den Begriff der Neugier durch den der Wissbegier zu ersetzen. Die Unterscheidung stammt von Alexander von Humboldt. Denn Wissenschaften und Massenmedien wollten in Wahrheit vom Neuen nichts wissen. Bolz: »Es gibt keine Massennachfrage nach echter Kreativität. Und gerade deshalb ist Kreativität im 20. Jahrhundert oft genug zur Parodie auf sich selbst geraten – man denke nur an die Creative-writing-Kurse, Brainstorming, Teamwork, oder den Express-yourself-Kult.« Des Medienwissenschaftlers Wort in des Pädagogen Ohr!
Rainer Hank widmet sich dem Verhältnis des Marktes zum Neuen, Jörg Lau fragt sich, wer denn eigentlich an der Spitze des Fortschritts marschiert. Der »Zeit«-Redakteur macht sich über die sogenannte Glücks-»Forschung« lustig. Denn nach deren Ergebnissen hätten sich nirgendwo so viele Menschen als glücklich bezeichnet wie ausgerechnet in Nigeria.
Der Historiker Christian Meier steckt die Grenzen der Polis bezüglich des Neuen ab. Er beschreibt die Hochkultur der Griechen und fragt, warum die Griechen über ein allgemeines Bewusstsein ihres Könnens ihre Gesellschaftsordnung nicht erhalten konnten. Enno Rudolphs Aufsatz über die Renaissance endet in einem deutlichen Bekenntnis, das vielleicht stellvertretend den Tenor dieses geistvollen Bandes zusammenfasst. Rudolph spricht sich dagegen aus, Europas Grenzen nach Marktinteressen zu definieren. Europa solle dagegen seine kulturellen Axiome wie Toleranz, die Trennung von Religion und Politik und die Autonomie avant la lettre zur Selbstdefinition nutzen und sich damit deutlicher von anderen Weltregionen abgrenzen.
geschrieben am 30.01.2009 | 593 Wörter | 3721 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen