Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
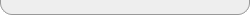
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Generaloberst Ludwig Beck – Eine Biographie
| ISBN | 3506728741 | |
| Autor | Klaus-Jürgen Müller | |
| Verlag | Schöningh GmbH & Co KG | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 836 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | gebundene Ausgabe |

Rezension von
Max Bloch
„Welcher Mann des 20. Juli ist uns noch gut genug?“, fragte am 22. April 2008 Günther Gillessen in der FAZ angesichts der skandalösen Umbenennung des Freiburger Gerhard-Ritter-Preises. Die zeitgemäße und schlicht unhistorische Mode, die Maßstäbe heutiger political correctness an den nationalkonservativen Widerstand gegen Hitler anzulegen, steht in voller Blüte und geht an den entscheidenden Fragen vorbei. Um so mehr ist zu begrüßen, wenn sachkundige Historiker durch eine biographische Betrachtung der Akteure das Bewusstsein ihrer historischen Gebundenheit und dadurch auch der Größe ihrer individuellen Entscheidung zu stärken oder auch nur zu wecken vermögen. Klaus-Jürgen Müller hat mit seiner großen Biographie über Generaloberst Ludwig Beck hierzu beigetragen und die Ergebnisse einer jahrzehntelangen militärgeschichtlichen Arbeit zu dem Lebensbild eines außergewöhnlichen deutschen Generalstabsoffiziers verdichtet. Dabei räumt er sowohl mit der oben skizzierten moralischen Überheblichkeit nachgeborener Historiker als auch mit den „wohlmeinenden Legenden einer integralen Widerstandsforschung“ auf, die Beck zum nachgerade „geborenen“ Widerständler stilisierte und damit einer ähnlich „linearen“, zielgebundenen Geschichtsbetrachtung fröhnte. Die „Bescheidenheit“, mit der er dabei zu Werke geht und auf die nüchterne Darstellung der Fakten beschränkt, verleiht dem Buch in unserer urteilsfreudigen und thesenreichen Zeit einen zeitlos-soliden Wert.
weitere Rezensionen von Max Bloch

Tatsächlich ist – wie Ritter oder Goerdeler – auch Ludwig Beck mit den Rastern demokratischer Gesinnungstreue nicht zu fassen. Im Gegenteil war es, wie Müller herausarbeitet, gerade das militärische Elitenbewusstsein, das als weltanschauliche Konstante sein Leben durchzieht und das mit den Gegebenheiten einer demokratischen Parlamentsarmee sicher schwer zu vereinbaren wäre. Ist uns Ludwig Beck, kann uns Ludwig Beck also überhaupt noch „gut genug“ sein? 1880 in eine hessen-nassauische Honoratiorenfamilie hineingeboren, setze er die militärischen Traditionen der Familie fort, trat nach bestandenem Abitur in ein preußisches Regiment ein und rückte 1913 als Hauptmann in den Generalstab auf. Seit 1916 Stabsoffizier der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz, fiel er seinen Vorgesetzten als besonders vielversprechender Soldat auf. Zu dem Kronprinzen selbst entwickelte sich sogar ein enges persönliches Verhältnis. Die Umstände der Niederlage, die Flucht des Kaisers, die überstürzten Friedenswünsche Ludendorffs, schließlich die Revolution belasteten ihn – wie viele seiner Kameraden – schwer: „Ein solcher Abgrund von Gemeinheit, Feigheit und Charakterlosigkeit“, so schrieb er an seine Schwägerin, „den hatte ich bis dahin für unmöglich gehalten.“
Gleichwohl wurde Beck in das 100.000-Mann-Heer der Republik übernommen. Ein strenger, aber gerechter, väterlicher und von seinen Untergebenen vielfach verehrter Vorgesetzter, stellte er sich im Ulmer Reichswehrprozess 1930 vor seine Offiziere Scheringer, Ludin und Wendt, die der Agitation für die NSDAP angeklagt waren. Das sicherte ihm einen scharfen Rüffel von Reichswehrminister Groener (der ihn sogar „wegen nationalsozialistischer Tendenzen“ aus der Reichswehr ausstoßen wollte) als auch die Anerkennung Hitlers, der im Gerichtssaal auf ihn aufmerksam wurde. Beck stand, wie diese Episode zeigt, dem Nationalsozialismus grundsätzlich positiv, ja hoffnungsvoll gegenüber, zumal er sich von einer „wehrfreundlichen“ Regierung nicht nur die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und eine forcierte Aufrüstung als Grundlagen einer – notfalls auch militärisch durchzusetzenden – Revisionspolitik, sondern ebenso auch die Restauration der traditionell privilegierten Stellung des Offizierskorps im Staat versprach. Die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten wurde von ihm vor diesem Hintergrund als „der erste große Lichtblick seit 1918“ begrüßt.
Im Herbst 1933 zum Chef des Truppenamtes und damit faktisch zum Generalstabschef ernannt, war Ludwig Beck auf der Grundlage jener Zwei-Säulen-Theorie, nach der Reichswehr und Partei, politische und militärische Führung – wie einst zu Kaisers Zeiten – als gleichberechtigte Partner die Geschicke der Nation bestimmten, zur Zusammenarbeit mit Hitler bereit. Erst unter dem Eindruck der sich steigernden Ansprüche der SS, der Ermordung der Generale von Schleicher und von Bredow – von Müller als „ein tiefer Einbruch in die eigene Wertewelt“ eingeordnet – und der würdelosen Intrige gegen seinen Vorgesetzen Freiherrn von Fritsch ging der Generalstabschef zur Abwehr über, zu einem Kampf „um“ Hitler, der schließlich zu einem Kampf „gegen“ Hitler wurde. Um einen Staatsstreich ging es, wie Müller herausarbeitet, trotz der von Himmler geschürten Befürchtungen und der Hoffnungen einzelner Oppositioneller 1937/38 nicht, sondern eher um eine im Grunde systemimmanente Kritik an Hitlers militärischer Risikopolitik, die Beck, ganz einer traditionellen, nationalkonservativen Revisions- und Großmachtpolitik verpflichtet, als überstürzt ablehnte. Im August 1938 legte er, der innerlich nicht geteilte Entscheidungen mitzutragen sich weigerte, sein Amt als Generalstabschef des Heeres nieder.
Fortan wirkte er zunächst als „Kassandra ohne Überzeugungskraft“. Die Erfolge der Wehrmacht durch die von seinem Schüler Manstein maßgeblich entwickelte „Blitzkrieg“-Strategie hatten seine Warnungen entkräftet und ihn in einem hitlergläubigen Offizierskorps isoliert. Durch seine offene, in zahllosen Denkschriften formulierte Kritik an Hitlers Kriegs- und Rassenpolitik (über die Verbrechen in Polen war er durch Kameraden informiert) wurde er zum Zentrum, zum „moralischen Haltepunkt“ der Oppositions- und Widerstandsbewegung. Anders als die „debattierenden Politiker“ zog der nüchterne Generalstäbler Beck jedoch ein ruhiges Abwägen und klares Handeln den überschießenden Neuordnungskonzepten vor und ist von dem ambitionierten Goerdeler deshalb als „Zauderer“ mißverstanden worden. Tatsächlich ist in Beck spätestens mit der Katastrophe von Stalingrad die Entscheidung zum Attentat auf Hitler (von Goerdeler stets abgelehnt) gefallen. Damit veranschlagte er als einer der wenigen hohen Offiziere seiner Generation die Verantwortung vor dem Vaterland und die „Entscheidung des Gewissens“ höher als die Eidesbindung an den „Führer“ – eine soldatische Entscheidung letzter Konsequenz, die er am 20. Juli 1944 mit seinem Freitod bezahlte. Ludwig Becks langer und schmerzvoller Entscheidungsweg, der letztlich ein Opfergang wurde, ist von Klaus-Jürgen Müller faktenorientiert, doch einfühlsam, eingebettet in die größeren historischen Entwicklungen, nachgezeichnet worden. Daraus ist eine, von einigen ärgerlichen Pannen bei der Manuskriptbearbeitung abgesehen, gut lesbare und mit dankenswerter Klarheit verfasste Biographie über einen Mann entstanden, der Vorbild sein kann, auch ohne „Demokrat“ gewesen zu sein.
geschrieben am 06.05.2008 | 902 Wörter | 6181 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen