Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Die Wundertäter
| ISBN | 3886807657 | |
| Autor | Nina Grunenberg | |
| Verlag | Siedler | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 316 | |
| Erscheinungsjahr | 2006 | |
| Extras | - |
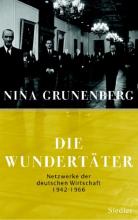
Rezension von
Gérard Bökenkamp
Nina Grunenberg schreibt, Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik sei nur "halb beschrieben ohne ihr Personal", daher habe sie sich entschlossen, die "Grabplatten ├╝ber den Wundert├Ątern" anzuheben und Licht in die Geschehnisse zwischen dem Ende des Dritten Reiches und dem wirtschaftlichen Wiederaufstiegs zu bringen. Das ist ihr gelungen und man ist verleitet zu sagen, ohne das "Personal ist die Wirtschaftsgeschichte gar nicht geschrieben."
weitere Rezensionen von G├ęrard B├Âkenkamp

Denn Wirtschaft wird nicht von Statistiken, Kennziffern und Strukturen gemacht, sondern von Menschen aus Fleisch und Blut.
Dem entsprechend stehen im Mittelpunkt der Darstellung hervorragende biographische Skizzen, die zu einer Schilderung verwoben werden, die ein gro├čes Gesamtbild des Wirtschaftswunders entstehen l├Ąsst. Damit ist ihr Ansatz traditionell und zu gleich modern. Traditionell, indem sie auf das Mittel der "Erz├Ąhlung" zur Beschreibung des historischen Gegenstandes zur├╝ckgreift. Modern, indem sie den in den Sozialwissenschaften immer popul├Ąrer werdende Konzept des Netzwerkes zur Erkl├Ąrung des Wirtschaftswunders heranzieht und seine Relevanz anhand der konkreten Abl├Ąufe und Pers├Ânlichkeiten nachvollziehbar macht.
Auf der Suche nach den Urspr├╝ngen des Wirtschaftswunders stellte Grunenberg fest, dass sie die Spur direkt sie in die R├╝stungsschmiede Speers zur├╝ckf├╝hrte: "Nicht die Anf├Ąnge der Bundesrepublik r├╝ckten n├Ąher, sondern die Schatten des Dritten Reiches wurden immer l├Ąnger." Viele der wichtigsten Akteure des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Gr├╝ndung der Bundesrepublik gingen aus "Speers Kindergarten" hervor. Das war die ironische Bezeichnung f├╝r die jungen Technokraten, die Hitlers R├╝stungsminister um sich versammelt hatte, der wiederum Konzepte des j├╝dischen R├╝stungsorganisators des Ersten Weltkrieges Walther Rathenau ├╝bernahm. Damit deutet sich bereits jene Kontinuit├Ąt ├Âkonomischer Effizienz der deutschen Wirtschaftf├╝hrer ├╝ber die unterschiedlichen Systeme hinweg an, die ihren Ausdruck in der "erstaunlich geringen Elitenzirkulation" nach 1945 fand. "Aus ihrem Blickwinkel war es offenbar kein Unterschied, ob drau├čen eine Monarchie, eine Republik oder eine Diktatur die Regeln bestimmte."
Eine richtige "Stunde Null" gab es laut der Autorin nicht, denn ein wichtiger Teil der Wirtschaftselite hatte sich schon fr├╝hzeitig auf die Zeit nach der Niederlage vorbereitet. Der aus einer ├Ąlteren Generation stammende Friedrich Flick hatte schon w├Ąhrend des Krieges seine Zentrale von Berlin nach D├╝sseldorf verlegt, weil er ├╝ber die Aufteilung der Besatzungszonen informiert war. Im Ruhrgebiet hatten die Bergwerksdirektoren schon seit 1942 "mehr oder minder unverhohlen" ├╝ber den Krieg hinausgeplant. Der Generaldirektor der Mannesmann R├Âhrenwerke Wilhelm Zangen unterst├╝tzte nach au├čen hin das NS-Regime finanzierte gleichzeitig jedoch die Nachkriegsplanungen des "Instituts f├╝r Industrieforschung" des National├Âkonomen Ludwig Erhard.
Ob mit dem Handel mit ├äpfeln, Dachpfannen D├╝ngemitteln oder der Zucht von Dackeln, die Wundert├Ąter verstanden es sich in Nachkriegszeit ├╝ber Wasser zu halten und selbst in den alliierten Gef├Ąngnissen h├Ârte ihr planerischer Verstand nicht auf t├Ątig zu sein. Und das Erstaunliche ist, sie erreichten ihr Ziel: Sie gewannen ihre Wirtschaftsimperien zur├╝ck oder bauten neue auf. Es gibt offensichtlich keine bessere Versicherung gegen die Wirren der Zeit als einmal gelerntes unternehmerisches Handwerkszeug, pers├Ânliche Kontakte und Tatkraft. Bei allen moralischen Einw├Ąnden gegen├╝ber der NS-Vergangenheit der Wundert├Ąter" kommt Grunenberg zu dem Schluss: "Andere als sie waren nicht da. Ungl├╝cklich sind wir nicht mit ihnen geworden."
Das Buch ist spannend wie ein Wirtschaftskrimi und zu gleich ein enorm wichtiger Beitrag zur Zeitgeschichte. Wer dieses Buch gelesen hat, hat enorm viel ├╝ber das Verh├Ąltnis von Macht und Wirtschaft gelernt und vielleicht noch mehr ├╝ber die Urspr├╝nge unseres Wohlstandes, den wir gelernt haben, f├╝r selbstverst├Ąndlich zu halten.
geschrieben am 03.12.2006 | 534 Wörter | 3508 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergńnzungen