Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Die Aldi-Diät für Deutschland
| ISBN | 3430200113 | |
| Autor | Dieter Brandes | |
| Verlag | Econ | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 222 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | gebundene Ausgabe |
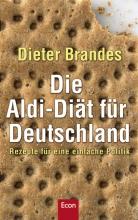
Rezension von
Lesefreund
Dass es neben einer einfachen Lösung für ein Problem immer auch eine kompliziertere Variante gibt, ist sicherlich kein Geheimnis. Es kommt eben auf den Problemlöser selbst und seine jeweilige Vorgehensweise an, die über den Erfolg bzw. Misserfolg einer Sache entscheidet. Dieter Brandes, der lange Jahre für Aldi im Management wichtige Entscheidungen getroffen hat, macht mit seinem Buch auf eine Problemlage aufmerksam, die wohl jahre-, wenn nicht jahrzehntelang unterschätzt worden ist: Manche Dinge werden in Deutschland â speziell im Bereich der Politik â einfach zu kompliziert angegangen.
weitere Rezensionen von Lesefreund

Zu dieser Einschätzung ist zunächst einschränkend zu sagen, dass die Abläufe in einem Unternehmen nicht ohne weiteres mit denjenigen einer Partei oder etwa einer Fraktion verglichen werden können. An dieser Stelle würde Brandes sicher dagegenhalten und betonen, dass sicherlich nicht alle Abläufe oder Entscheidungsprozesse aus der Wirtschaft auf die Politik übertragbar seien, aber aus seiner Sicht eben doch vielmehr als man gemeinhin annimmt. Und genau an dieser Stelle sitzt laut Brandes der springende Punkt: bei der Denkweise. Die Art, wie in der Wirtschaft administrative Entscheidungen gefällt werden, unterscheidet sich möglicherweise nur auf den ersten Blick bzw. nicht unbedingt in groÃem Umfang von vergleichbaren Abläufen in der Politik.
Angesichts der Fülle von Verordnungen, Gesetzen und Vorschriften, die es in Deutschland gibt, wird der Einzelne respektive ein Unternehmen â oder etwa eine Regierung â vor massive verwaltungstechnische Probleme gestellt, bevor es überhaupt zu den ersten Handlungsschritten â den entscheidenden ersten Schritten â kommen kann. Der Regularien-Kosmos in Deutschlands Bürokratie ist derart komplex (geworden), dass vielfach unternehmerische Kräfte erlahmen, bevor sie sich überhaupt in Tätigkeit entfalten können. Dies bedeutet nicht selten einen groÃen Verlust für Deutschlands Wirtschaft und seine ökonomische Leistungsfähigkeit â einen Verlust, der das Ganze schwächt und den Einzelnen zudem in wichtigen Teilen seiner Handlungsfähigkeit beschneidet. Als Ausweg aus dieser Situation der gesetzlichen Ãberregulierung sieht Brandes die Ãbertragung des so genannten Aldi-Prinzips aus der Wirtschaft auf das Feld der Politik.
Mit der Hervorhebung von drei Hauptgesichtspunkten sucht Brandes sein Modell â wie könnte es bei einem Management der Einfachheit anders sein â prägnant zu umreiÃen. Als steht natürlich Einfachheit selbst, die nahe legt, dass dem Einzelnen Vorschriften und Paragraphen so simpel und verständlich wie möglich erklärt werden sollen. Gesetze sollen Dinge vor allem regulieren, damit sie auf eine bestimmte Art und Weise angegangen werde können. Bewirken Vorschriften (inzwischen) jedoch, dass Dinge erst gar nicht mehr unternommen werden, weil das administrative Procedere für ihre Regulierung zu kompliziert geworden ist, führen diese Vorschriften den Gedanken des Regulierens ad absurdum. Im Rahmen seiner Vorstellung des Prinzips der Einfachheit fordert Brandes zudem, dass die lange Reihe von Ausnahmefällen und Sonderregelungen, die es im deutschen Vorschriftenapparat gibt, drastisch verringert oder am besten ganz aus der Welt geschafft wird. Auf diese Weise könnte eine Fülle von Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld verhindert werden, was nicht nur die Justiz und deren zuständige Gerichte entlasten würde.
Mit dem zweiten und dritten Hauptgesichtspunkt seines Managements der Einfachheit, der Konzentration auf das Wesentliche und der Forderung nach Dezentralisierung, macht sich Brandes für eine Zurückhaltung des Staats insgesamt stark. Gegenüber der Wirtschaft sollte er nach Möglichkeit eher eine Aufsichtsfunktion übernehmen, als einzelne Prozesse selbst steuern oder anregen zu wollen. Dies würde dazu beitragen, seine Glaubwürdigkeit im Ganzen zu erhöhen, da er mit weniger Kompetenzen eben auch weniger Forderungen von Seiten der Bürger zu erfüllen hätte, wodurch Enttäuschungen für die Zukunft vermieden werden könnten. Bei der Dezentralisierung geht es Brandes darum, einzelne Aufgaben nach Möglichkeit vor Ort anzugehen. Die föderale Struktur der Bundesrepublik könnte nach seiner Einschätzung â ähnlich wie heutzutage die Schweiz â enorm von einer verringerten Gesamtkompetenz der Bundes profitieren, der sich zukünftig stärker um einzelne Rahmenbedingungen kümmern würde und im Ganzen eher als Förderer des Wettbewerbs der Bundesländer untereinander aufträte, anstatt sich lähmend über das Ganze gleichsam zu stülpen.
Anhand des Beispiels Neuseeland zeigt Brandes auf, wie die von ihm geforderten Veränderungen für eine positive Entwicklung und eine gröÃere Zufriedenheit der Menschen sorgen können. Was an seinem Konzept überzeugt, ist die Betonung der Machbarkeit, die eine Reduktion der (Gesetzes-)Komplexität nach sich ziehen sollte, um die Dinge besser handhabbar zu machen. Der Einzelne würde in diesem Entscheidungsspielraum freier erscheinen und könnte sein Handlungspotenzial dort entfalten, wo es hingehört: Nicht im Bewältigen von Verordnungen und Vorschriften, sondern im Lösen von Problemen und im Schaffen von Mehrwerten.
geschrieben am 28.10.2007 | 708 Wörter | 4521 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen