Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Wie zusammen leben
| ISBN | 3518124021 | |
| Autor | Roland Barthes | |
| Verlag | Suhrkamp | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 282 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | - |
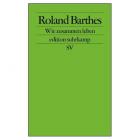
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Am 7. Januar 1977 hält Roland Barthes seine Antrittsvorlesung am Collège de France. Die Versammlung der Professoren des Collèges hatte ihn am 14. März 1976 auf den Lehrstuhl für Literatursemiologie gewählt – auf Vorschlag von Michel Foucault. Allerdings nur mit einer Stimme Mehrheit. Dem akademischen Betrieb Frankreichs war er wohl immer ein wenig suspekt geblieben.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Denn Barthes akademische Laufbahn hatte sich bis zu dieser Berufung sowohl institutionell wie geographisch außerhalb der Universität abgespielt. Barthes (1915-1980) war ohne agrégation, der in Frankreich obligatorischen Prüfung für die Zulassung als Lehrer im höheren Schuldienst. Er lehrte in Rumänien, Ägypten und Marokko – stets jedoch an universitären Randbereichen. Die Berufung bedeutete dann seine wissenschaftliche Adelung. Foucault hatte seinen Vorschlag damit begründet, Barthes besitze die seltene Gabe »Intelligenz und Schöpfung« zu verbinden. Aus diesem Grunde bedürfe er keiner weiteren Qualifikation.
Der Suhrkamp Verlag bringt nun seine erste Vorlesung in vollständiger Form heraus. Es handelt sich bei dem Text allerdings nicht um den niedergeschriebenen mündlichen Vortrag, sondern um den Abdruck von Barthes’ schriftlich vorbereitetem Vorlesungstext nebst ergänzender Karteikarten. Dieses Veröffentlichungskonzept ist richtig, war es doch seine Auffassung, das zu Sagende würde sich letztlich im Vortrag fügen. Deshalb hatte der Dozent auch niemals fertig ausformulierte, jeden Quergedanken erfassende Manuskripte als Grundlagen seiner Vorlesungen.
In Frankreich ist der Text bereits 2002 in der Form eines großformatigen Heftes erschienen. Weiter sollen in der französischen Ausgabe die an eine Schreibmaschine erinnernde Schrifttype und der manuskriptartige Satzspiegel den Eindruck eines BUCHES verhindern. Die französischen Herausgeber betonten in ihrem Vorwort den Charakter als »verfielfältigtes Typoskript, […] der dem Inhalt, den er birgt und verbreitet, gleichsam einen Rahmen gibt«. In Deutschland erscheint der Text in der Edition Suhrkamp in gewohnter Aufmachung.
»Allein leben zu wollen und zugleich, ohne Widerspruch dazu, zusammen leben zu wollen« ist die Utopie aber zugleich Frage und These von Barthes. Dies alles existiert also. Es existiert nebeneinander, miteinander. Barthes sieht keine Konkurrenz. Weder Einsiedlerexistenz noch Unterordnung unter das Reglement eines Kollektivs hat das Primat.
Barthes sucht in der ersten Vorlesung nach einem Wort zur Beschreibung dieses Spannungsverhältnisses, das immer auch die menschliche Existenz essenziell ausmacht. Er stößt darauf »zufällig« bei der Lektüre einer Schilderung der Lebensweise von Mönchen auf dem heiligen Berg Athos in Griechenland. Dies Wort ist »Idiorrhythmie«. Zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern idios (eigen) und rhythmos (Rhythmus oder Maß). Den Mönchen gelingt es durch ihre idiorrhythmische Lebensweise, ihr(en) Subjekt(-Rhythmus) beizubehalten. Mithin gelingt ihnen, was vielen Menschen in der hypermodernen, sich globalisierenden und uns einnehmenden Welt aus den Händen gleitet: Die Bewahrung der eigenen Subjekt-Qualität. Die Mönche leben in Einzelzellen. Ihr Essen nehmen sie für sich allein ein. Anders als in Klöstern üblich, dürfen sie die Dinge behalten, die sie bereits beim Ablegen des Gelübdes besaßen. Sogar die Teilnahme an den Gottesdiensten ist ihrem Belieben überlassen. Barthes sieht darin ein Musterbeispiel für die Erhaltung der Souveränität des Individuums inmitten der engsten denkbaren Gemeinschaftlichkeit. Kein Widerspruch ist für den freien Denker der Verweis auf die Abtei Thelem, diesem in die Geistesgeschichte eingegangenen Roman-Kloster des genialischen Francois Rabelais. Anstatt aller Zwänge steht hier über dem Portal: »Fais que voudras«.
Barthes unterstellt seine Frage »Wie zusammenleben?« einer negativen Dekonstruktion, einer - nennen wir es lieber Relativität als Negativität -, die sich als ASKETISCHER METHODE einen eigenen und eigen-willigen Zugang zu den Fragestellungen von menschlicher Gemeinschaft und seelischer Ich-Behauptung bewahrt. Dies haben uns die Franzosen vielleicht voraus: Eine Vorlesungsreihe abzuhalten, - ohne von vornherein das Ergebnis vor Augen zu haben.
geschrieben am 26.07.2008 | 565 Wörter | 3714 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen