Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Die Vobereitung des Romans. Vorlesung am Collège de France
| ISBN | 351812529X | |
| Autor | Roland Barthes | |
| Verlag | Suhrkamp | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 571 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
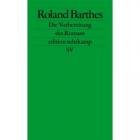
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Der Name Roland Barthes ist in Deutschland nicht groß bekannt. Es sind eher Eingeweihte, die überhaupt wissen, wer er war, die dann allerdings meist nur eine einzige These dieses französischen Gelehrten kennen.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Vermutlich hängt die Wahrnehmungsschwäche in Deutschland dieses ungeheuer innovativen Professors an der Collège de France damit zusammen, dass er sich so schwer klassifizieren lässt. Der im Frühjahr 1980 durch die Folgen eines Autounfalls ums Leben Gekommene sitzt mit seinem Werk wahrlich zwischen allen Stühlen. Auch diese, seine letzte Vorlesung entzieht sich allen formal-wissenschaftlichen Voraussetzungen an die Lehre. »Die Vorbereitung des Romans« thematisiert die Motivation des Subjekts zur Schaffung eines Romans. Wobei hier der Roman Metapher für das schöpferische Schreiben schlechthin ist. Der Vorlesungszyklus wurde von Barthes zwischen Dezember 1978 und März 1979 und zwischen Dezember 1979 und März 1980 im Auditorium Maximum an der Place Marcelin-Bethelot samstagmorgens abgehalten.
Barthes war seit den 1950er Jahren daran gelegen, mit seinen Untersuchungen
zum Nullpunkt der Schreibweise, zur Lust am Text als genuin erotischer Erfahrung, den Mythen des Alltags, zu »Sade, Fourier, Loyala« und den Sprachen der Mode der bisherigen Literaturwissenschaft eine grundlegend andere Herangehensweise zu geben. Im Fokus dieser neuen Sichtweise steht das Subjekt und damit einhergehend die Betonung des absolut Subjektiven aller Literatur. Dies war natürlich zu dieser Zeit ein Frontalangriff auf die herrschende strukturalistische Objektivität.
Herausragend ist Barthes Werk nicht nur wegen seiner die Pseudo-Objektivität wegfegenden Betrachtung auf den Gegenstand Literatur. Seine eigene an allen Reibungen herausgeschliffene Schreibweise übertrifft an »essayistischer Radikalität« (Frankfurter Allgemeine) alles bis dato in der Literaturwissenschaft Dagewesene. Das Erschreckende ist: Barthes Ball ist nicht aufgenommen worden. Die Sekundärliteratur ist dahinter seit seinem Tod zurückgefallen.
Denn der 1915 in Bayonne Geborene hatte sich weit vorgewagt. Die Ausführungen seiner Vorlesung kreisen um die Frage nach dem Schreiben als dem Urgrund des Subjektiv-Imaginären. Man könnte auch sagen: Um den Gipfelpunkt einer literarischen Utopie.
Barthes stellt das Literatur schaffende Subjekt in vielfältigen Facetten dar als eine spirituelle Wunschmaschine, einen Traumfänger seiner eigenen Phantasien. In seinem Willen zum Schreiben findet dieses Subjekt den Fixpunkt seines Seins, - mithin den zentralen Kristallisationspunkt jedweder Selbsterkenntnis. In der Konsequenz erscheint der Roman nicht mehr als literarische Gattung, »sondern als eine Form des Schreibens, die imstande ist, das Schreiben selbst zu transzendieren «.
Barthes’ Vorlesung hatte absoluten Kultstatus. Zuhörer aus den verschiedensten Fächern strömten nach der Öffnung der Türen eiligst in den riesigen Hörsaal, um sich einen Platz zu sichern. Chick war es, eine Zeitschrift unter dem Arm zu haben, in der gerade ein Aufsatz von Barthes abgedruckt worden war. Viele Hörer ließen ein Aufzeichnungsgerät mitlaufen. Teilnehmer berichten von der flüssigen Vortragsweise, dem Timbre voller Ernst und gleichzeitig Verführung. Von rhetorischen Qualitäten, die Barthes’ natürlicher Autorität eine unendliche Güte verliehen.
Eine Kostprobe aus Barthes' nun erstmals in Deutsch veröffentlichten Aufzeichnungen dieser grandiosen, letzten Vorlesung:
»Rimbaud ist modern (Begründer der Moderne) nicht oder nicht so sehr durch seine Schriften als durch das schlagartig Erhellende seines Bruchs. Seine Modernität liegt nicht so sehr in seiner Radikalität, Reinheit oder Freiheit, sondern, darin, daß er absehen läßt – oder sichtbar macht - , daß das Subjekt – das Subjekt der Sprache – gespalten ist, schize, wie ein gefurchter Weg, bei dem jede Spur geradeaus, parallel zur anderen dahineilt; als hätte Rimbaud zwei gegeneinander abgeschlossene ‚Bestimmungen’ in sich gehabt: Eine zur Poesie (durch das Gymnasium), die andere zum Reisen (durch die Ablehnung der Mutter? Banal? Wer weiß?); er hat zwei diskontinuierliche Sprachen gesprochen: Zwischen dem Dichter, dem Reisenden, dem Kolonisten und dem am Ende Gläubigen (Paterne Berrichon, Claudel) gibt es kein verbindendes Gelenk, und ebendiese Schize wirkt als Faszination der Moderne: Machiavelli sagt von Lorenzo de’ Medici (ernst und wollüstig), er habe zwei verschiedene Wesen in sich, ‚verbunden durch ein unbegreifliches Gelenk’.«
Barthes’ Vorlesungen nocheinmal nachzulesen ist wie Flanieren durch Paris. Die Stadt leuchtet auf in all ihren glitzernden Lichtern. Es lärmt der Verkehr. Um die Ecke ist es still. Ein kleines Bistro. Flanieren kann man zu Fuß. – Oder intellektuell. Barthes ist darin furios. Ein Großmeister des Zusammenfügens von bisher getrennt Gelesenem. Diese letzte Vorlesung ist für weit größere Kreise interessant als nur die Literaturwissenschaftler. Eine geistige Reise über vielerlei Umwege, Pfade. An ihrem Ende könnte der Spruch des Tores von Delphi leicht abgewandelt stehen: Ich habe über mich selbst gelernt.
geschrieben am 12.08.2008 | 700 Wörter | 4472 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen