Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
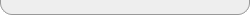
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Die Behauptung des Dandys. Eine Archäologie
| ISBN | ||
| Autor | Fernard Hörner | |
| Verlag | Transcript | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 354 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |

Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
»Éternelle supériorité du Dandy. Qu’est-ce que le dandy? (Ewige Überlegenheit des Dandys. Was ist der Dandy?)«, fragte Charles Baudelaire in den Fusées und traf damit den Nagel Dandytum auf den Kopf. Das Dandytum, das wie ein Stachel im Fleisch der Moderne sitzt.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Fernand Hörner geht in seiner gerade veröffentlichten Studie den Phänomen des dandysme nach: Zu diesen Phänomen gehört, dass das Dandytum permanent für tot erklärt wird und viele Untersuchungen mit dem Fazit enden, das Dandytum sei längst erledigt. Heute könne niemand mehr Dandy sein. Entweder weil der Ur-Dandy George Brummell unkopierbar sei oder weil die moderne Massengesellschaft mit ihrer Mode von der (Kaufhaus)-Stange keinerlei dandyistisches Sein mehr zulasse. Manche versteigen sich gar zu der mutigen Aussage, es bestehe auch gar kein Bedarf mehr an Dandyismus.
Hörner, Dozent für französische Literatur- und Kulturwissenschaft in Wuppertal, pflügt das Feld tiefer als üblich. Seine Analyse geht davon aus, »dass sich für die Behauptungen des Dandys ein gemeinsames Zusammenspiel verschiedener Taktiken der Behauptung formulieren lässt, ähnlich wie Foucault in der Archéologie du savoir Formationsregeln für einen Wissenschaftsdiskurs formuliert. Auf die Behauptung des Dandys übertragen, wird es erstens auf die Behauptung des Dandys als Subjekt, zweitens um die Behauptung des Autors als Dandy, drittens um die Rolle von Originalität und Exzentrik für die Behauptung des Dandys gehen. Das Zusammenspiel dieser Behauptungen wird viertens schließlich als Taktiken der Behauptung untersucht.«
Aufgrund aufwendiger Quellenstudien gelingt es Hörner, die substanzielle Arbeit von Otto Mann »Der moderne Dandy«, der damit 1924 bei Karl Jaspers promovierte, weiterzuführen. So gelingt ihm die Darstellung, warum Oscar Wilde, trotz seiner Erscheinung als »Karikatur dieses Ideals« (Gerd-Klaus Kaltenbrunner) eben doch ein waschechter Dandy war. Mit seinem einzigen Roman »Dorian Gray« erweist Wilde seinen Dandy-Vorfahren vielfache Referenzen. Nicht nur liefert Vivian Grey, der Roman des mit Wilde befreundeten Benjamin Disraeli, den Nachnamen seines Romanjünglings. Die ästhetisch-ausschweifenden Feste von Dorian sind eine Anspielung auf die Feste von Byron in Newstead Abbey. Wilde verweist ausdrücklich auf Gautier, wenn er Dorian beschreibt, für ihn sei das Leben als solches die erste aller Künste. »Dorians Sinn für Ästhetik wird so mit Gautiers Faszination für ästhetische Eindrücke verglichen, wie er sie […] gegenüber den Goncourts zum Ausdruck bringt. Die Definition des Dandyismus als Versuch, die Modernität des Schönen zu erreichen, wiederholt Baudelaires Definition des Dandys, die Wilde auch im Theaterstück A Women of No Importance aufnimmt.« Neu, analysiert Hörner, sei im Dorian Gray die Darstellung des Lebens als größte Form der Kunst. Für Wilde ist es das Leben, das die anderen Künste überhaupt wirken lasse. Jedwede Kunst dient nur dazu, das ästhetische Leben in noch hellerem Glanz erstrahlen zu lassen.
In vielen eindrucksvollen Teil-Untersuchungen im Rahmen seiner Gesamtstudie nähert sich der Autor der »Behauptung des Dandys«. Zu dieser Behauptung gehört auch das Übersetzen und sozusagen Über-Setzen. Denn viele Dandys waren zugleich Dandy-Schriftsteller und -Übersetzer. Die kleine, aber große Wirkung erzielende Studie vom exzentrischen Dandy Barbey d’Aurevilly über Brummell basiert in Teilen auf der Anekdoten-Sammlung von William Jesse (»The Life of Beau Brummell«), die es nicht in Französisch gab. So konnte Barbey die Überlieferungen des Bekannten von Brummell sich selbst nutzbar machen und poetisch-interpretierend weiter-schreiben. Hörner stellt dar, dass es neben dem sprachlichen Transfer, eine wichtige Zeitlang von der englischen in die französische Sprache, auch der personelle Transfer war, der das Dandytum stark beeinflusste: »Viele Franzosen, wie Chateaubriand oder de Stael, verließen Frankreich während der französischen Revolution oder des Empire, kehrten später zurück und brachten ihr Verständnis der englischen Lebensart nach Frankreich. Auf der anderen Seite kamen viele Engländer, um (zumindest zeitweise) in Frankreich zu leben, im Jahr 1830 stieg ihre Zahl auf 31.000. Der mit Brummell befreundete Rees Howell Gronow widmet in seinen Reminiscences and Recollections ein ganzes Kapitel dem Thema ‚An English Dandy in Paris’, in dem er diese Überschneidung der englischen mit der französischen Gesellschaft thematisiert.«
Das Phänomen des Totsagens des Dandytums führt dazu, dass immer wieder »der letzte Dandy« gekürt wird. Hörner, der normalerweise nur referiert, wird an dieser Stelle in seiner wissenschaftlichen Arbeit ironisch und belustigt sich über die häufig mangelnde Auseinandersetzung mit dem Dandytum bei derartiger Zuschreibung. Sarkastisch zitiert er auch das Männermagazin GQ mit der Modeempfehlung eines weißen Anzuges, der dessen Träger sogleich in die Nähe Baudelaires rücke.
Totgesagte leben länger. Hörner empfiehlt für eine eingehendere Untersuchung ob ihres Dandytums die Künstler Théodore Géricault, Gustave Courbet, Fernand Khnopff, Manet, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Jacques Monory, Gilbert & George und die Professoren der Düsseldorfer Kunstakademie Joseph Beuys, Jörg Immendorff und Markus Lüpertz.
Insbesondere in den letzten Kapiteln wären Urteile und ein eigener Standpunkt wünschenswert gewesen. Hörner begnügt sich mit der Dokumentation der Selbst-Darstellung und der Behauptung von anderen, jemand sei ein Dandy. Die Stellungnahmen der Betroffenen zu der Klassifizierung als Dandy hätten das Ergebnis vielleicht stärker konturiert. Dennoch sind Herangehensweise und dadurch gewonnener Abstand der Untersuchung insgesamt förderlich. Letztlich ist diese Kameraperspektive auf das Dandytum notwendig, weil es im Feuilleton einfach chic ist, einen Künstler als Dandy zu präsentieren. Würde er jedoch danach gefragt, ob er ein Dandy ist, würde er das natürlich verneinen. Ein echter Dandy MUSS es verneinen. Bei dem Umfang der Studie und dem augenscheinlichen Aufwand, den Hörner betrieben hat, wäre es absolut kleinlich, auf manchmal fehlende Quellen hinzuweisen. Die Untersuchung kann durchaus als bahnbrechend bezeichnet werden. Vorliegende Werke wie die von Hans-Joachim Schickedanz (»Ästhetische Rebellion und rebellische Ästheten«, 2000) oder Günter Erbes »Dandys – Virtuosen der Lebenskunst« (2002) werden vollkommen in den Schatten gestellt. Vom Tiefgang der Untersuchung ist die neue Studie am ehesten vergleichbar mit Hiltrud Gnügs fulminanter literaturwissenschaftlicher Arbeit »Kult der Kälte« von 1988. Aber diese beschränkt sich eben auf einen recht kleinen Ausschnitt. Fernand Hörners profundes Quellenwerk setzt im Moment den Maßstab in Sachen wissenschaftliches Dandytum. Es ist Ansporn, an vielen Punkten weiterzuforschen.
Bleibt die Frage: Qu’est-ce que le dandy?
geschrieben am 12.11.2008 | 952 Wörter | 6041 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen