Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Der Dollar Crash
| ISBN | 3938516690 | |
| Autor | Ellen Hodgson Brown | |
| Verlag | Kopp | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 637 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |
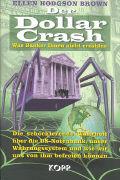
Rezension von
Gérard Bökenkamp
Es besteht inzwischen Einigkeit darin, dass die US-Notenbank durch ihre Niedrigzinspolitik nicht unwesentlich zu der aktuellen Krise beigetragen hat. Kritik an der Politik der Zentralbanken, ja sogar am heutigen W√§hrungssystem selbst mag also sachlich geboten sein, sie wird aber oft verkn√ľpft mit Verschw√∂rungstheorien unterschiedlicher F√§rbung. Die Anw√§ltin Ellen Brown hat in ihrem Buch ‚ÄěDer Dollar-Crash‚Äú eine umfassende Darstellung aus der Sicht der amerikanischen populistischen Bewegung vorgelegt.
weitere Rezensionen von Gérard Bökenkamp

Die populistische Bewegung entstand im 19. Jahrhundert als Agrarprotest gegen die Banken. Die Forderungen dieser Bewegung sind im Kern inflationistisch. Sie bevorzugen eine Politik des leichten Geldes, die es erleichtert, Schulden zu tilgen und somit den Interessen der Landwirte entgegenkamen. Darum lehnten sie den Goldstandard ab und forderten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Beibehaltung des Bimetallismus aus Gold und Silber.
Der Hauptvorwurf gegen das Zentralbankensystem ist, dass es in den H√§nden privater Bankiers liege. Die Politik des leichten Geldes ist aus dieser Sicht nicht das Problem. Der Staat solle sich das Recht aneignen, unbegrenzt Geld zu drucken. In der staatlichen Ausweitung der Geldmenge sieht die Autorin die M√∂glichkeit, den Wohlstand fast unbegrenzt zu erh√∂hten. Darin unterscheiden sich die Kritiker der populistischen Str√∂mung stark von der Kritik der √Ėsterreichischen Schule, die gem√§√ü der √Ėsterreichischen Konjunkturtheorie die Ursache der Finanzkrise gerade in der unbegrenzten Ausweitung der Geldmenge sieht.
Dass die unbegrenzte Ausweitung der Geldmenge unweigerlich in die Hyperinflation f√ľhrt, bestreitet die Autorin. Historische Beispiele daf√ľr, wie die Entwertung der amerikanischen W√§hrung w√§hrend des amerikanischen B√ľrgerkriegs und der gro√üen Inflation von 1923 in Deutschland interpretiert sie einfach um, als Folgen b√∂swilliger Spekulation. Ihr Idealbild ist das Mittelalter. Sie entwirft ein esoterisch anmutendes Bild einer matriachalen Welt ohne √∂konomische Sorgen, die durch die Herrschaft des Mannes und des Goldes abgel√∂st worden sei.
Die Autorin hat sich zum Teil ziemlich willk√ľrlich Fakten zusammengesucht, die ihre Hypothesen st√ľtzen und konsequent alle anderen vernachl√§ssigt. In dem Buch gibt es ein Feindbild, das f√ľr fast alle Verfehlungen auf der Welt verantwortlich gemacht wird, das sind die Privatbankiers. Es wird der Eindruck vermittelt, als w√§re die gesamte Welt am Verarmen und es w√ľrden nur eine Handvoll Finanzmagnaten profitieren. Der enorme Zuwachs des Wolstandes in den Jahrhunderten, die die Autoren im Gegensatz zum Mittelalter als eine Art dunkles Zeitalter darstellt, wird nicht mit einem Satz erw√§hnt, der Einfluss von Staaten, Politikern, Parteien und anderen Gr√∂√üen f√§llt in der Darstellung unter den Tisch. Das Buch ist Schwarz-Wei√ü-Malerei ‚Äď Interessant f√ľr alle, die auf der Suche nach einem einfachen Weltbild sind.
geschrieben am 07.12.2009 | 408 Wörter | 2553 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergšnzungen