Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
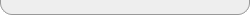
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Meine Preise
| ISBN | 3518420550 | |
| Autor | Thomas Bernhard | |
| Verlag | Suhrkamp | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 144 | |
| Erscheinungsjahr | 2009 | |
| Extras | - |

Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
»Eines der wichtigsten Bücher, die über den deutschen Literaturbetrieb nach 1945 erschienen sind«, lobt ein Rezensent. In der Tat: Thomas Bernhard war einer der rigorosesten Anprangerer dieses Zirkuses. Aber nicht nur der bekam seinen Zorn ab. Es waren die sich seiner Meinung nach selbst zerstörenden Gesellschaften, ökologisch und moralisch, auf die er seinen Hass ungefiltert auskotzte. Im Mittelpunkt seiner Lyrik, Prosa und Dramen stand er selbst – zumindest als Typus. Als Außenseiter, der von der kalten Umwelt in ihrer Absurdität nichts zu erwarten hat.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

Den Kopf zu schütteln oder die Nase zu rümpfen braucht darüber niemand. In dem nun erstveröffentlichten autobiographischen Buch »Meine Preise« sind ein knappes Dutzend kürzerer Texte zusammengefasst, die Bernhard wohl in dieser Form im März 1989 seinem Verlag zur Veröffentlichung überreichen wollte. Daraus ist also erst jetzt, exakt 20 Jahre nach seinem Tod etwas geworden; Bernhard starb nach einem körperlich leidensreichen Leben am 12. Februar 1989.
Schon der erste der Bernhardtschen Berichte seiner Preisverleihungen spricht Bände über den Zustand des Betriebs. Die Akademie der Wissenschaften in Wien verleiht ihm 1972 für »Ein Fest für Boris« den Grillparzerpreis. Bernhard weiß nichts über den Preis, weiß nicht, wer bisherige Geehrte sind. Und er sieht nicht ein, warum gerade für »Ein Fest für Boris«. Er kauft sich zwei Stunden vor Beginn des Festaktes einen Anzug, ein Hemd und eine Krawatte – und geht hin. Im Saal wird er weder empfangen noch anfänglich von den Verantwortlichen erkannt. Als die Zeremonie vorbei ist, strömen alle Gäste zum Podium, wo der Präsident der Akademie und die Kultusministerin noch sitzen. Schon während der gesamten Prozedur denkt er über deren »Geschmacklosigkeit und Gedankenlosigkeit« nach. Bernhard steht direkt neben dem Podium. »Nach einiger Zeit blickte die Ministerin in die Runde und fragte mit unnachahmlicher Arroganz und Dummheit in der Stimme: ja, wo ist denn der Dichterling?« Bernhard verlässt, so sein Bericht, den Saal, ohne dass dies von irgendjemandem zur Kenntnis genommen wird.
So ist die Großzügigkeit der Institutionen auch wiederum nur Egoismus. Man schmückt sich mit Künstlern. Umgibt sich mit dem Habitus, von der Kunst etwas zu verstehen. Und vor allem: die brotlose Kunst zu fördern. Nun wird »Meine Preise« gefeiert als »veritable Novität« (»Der Spiegel«). Dabei: Insgeheim wird sich so mancher freuen, dass Bernhards Aufzeichnungen zwei Jahrzehnte liegen geblieben sind. Zu heftig ist die Demaskierung der intellektuellen Gutmenschen, die selbstredend immer Verständnis hatten. Noch heute hört man sie raunen: Naja, man kann den Frust von Bernhard verstehen. Der muss dem Tod ja ständig von der Schippe springen. Aber er meint das sicher nicht so drastisch, wie er es schreibt.
Es ist dieser ungefilterte Hass auf Dummheit und Anmaßung, der so Bernhardisch ist und der das Büchlein tatsächlich zu der beachtenswerten Neuerscheinung werden lässt. Zu seinem Austritt aus der Akademie für Sprache und Dichtung erklärt der österreichische Schriftsteller: »Das Schriftstellergeschwätz in den Hotelhallen Kleindeutschlands ist ja wohl das Widerwärtigste, das sich denken läßt. Es stinkt aber noch viel stinkender, wenn es vom Staat subventioniert wird. Wie ja überhaupt der ganze heutige Subventionsdampf zum Himmel stinkt!« Bernhards Begründung ist zuerst in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« vom 8. Dezember 1979 erschienen und in diesen Band mit aufgenommen.
Dennoch hat auch Bernhard die Preisgelder gern in Empfang genommen. Um nicht zu sagen, in seine Lebensplanung integriert. So sagt er zum Literaturpreis der Freien und Hansestadt Bremen: »Nicht der Preis selbst war es, der mich aus meinem Stimmungs-, ja aus meiner Existenzkatastrophe errettete, sondern der Gedanke, mit der Preissumme von zehntausend Mark mein Leben abzufangen, ihm eine radikale Wendung zu geben, es wieder möglich zu machen.« Dieses Das-Leben-wieder-möglich-Machen sah dann so aus, dass sich Bernhard sofort einen völlig zerfallenen Bauernhof kaufte. Das Preisgeld reichte noch nicht einmal, um das abbruchreife Gemäuer, in dem jeder einzelne Boden durchgefault war, vollständig zu bezahlen. Die 5.000 Mark des Julius-Campe-Preises investiert er - wiederum spontan - in die Anschaffung eines weißen Triumph Herald mit roten Lederpolstern. Mit dem macht er nach 1.200 Kilometern einen Totalschaden, der ihn einmal wieder ins Krankenhaus bringt. Über sich selbst urteilt er mit ähnlicher Verve wie über andere: »Ich bin geldgierig, ich bin charakterlos, ich bin selbst ein Schwein.«
Von StĂĽck zu StĂĽck wirken die Berichte unfertiger, auch lustloser. So als habe Bernhard das Interesse verloren, nun noch die achte, neunte, zehnte Preisverleihung, die ja immer gleichen Mustern folgten, zu schildern. Der Eimer war eh vollgekotzt.
geschrieben am 05.02.2009 | 716 Wörter | 4219 Zeichen
Rezension von
Thierry Elsen
Der mediale Niederschlag auf Thomas Bernhards „Heldenplatz“ hatte kaum den Bodensatz berührt, da verabschiedete sich der Autor. Für immer. Sein letzter Akt bestand darin, Österreich mit einer kompletten Absenz seiner Werke zu „strafen“ – obwohl es sicherlich auch Stimmen gibt, die „strafen“ durch „beglücken“ ersetzen würden. Zeit seines literarischen Nachlebens (sprich solange Rechte auf dem Werk waren) sollte Österreich nie mehr eine Zeile des „Enfant Terrible“ sehen, hören, sprechen und lesen dürfen. Doch Österreich wäre nicht Österreich, wenn es nicht diesen letzten Wunsch des Autors zu umgehen versuchte, so als wolle es seinen Part in dieser Hassliebe bis zur Neige ausfüllen. Etliche Bernhard-Aufführungen liefen im Burgtheater, das Thomas Bernhard Archiv betreibt eifrig eine Werkausgabe, um nur einige Beispiele zu nennen.
weitere Rezensionen von Thierry Elsen

Nun ist es bereits 20 Jahre her, dass Thomas Bernhard starb. Pünktlich zu diesem Jubiläum wurde aus dem Nachlass des Autors „Meine Preise“ auf den Markt geworfen. Zugegeben: Das Buch erschien nicht in Österreich, sondern in Deutschland bei Suhrkamp. In der editorischen Notiz zu „Meine Preise“ wird suggeriert, dass Bernhard den Text 1989 selbst publizieren wollte. Es scheint als wollten die Herausgeber ihr Vorgehen legitimieren – doch einen definitiven Beweis dafür, dass Bernhard die Veröffentlichung von „Meine Preise“ vorgesehen hatte, steht aus.
Meine Preise – eine autobiografische Schrift?
Der schmale Band von knapp 140 Seiten, reiht sich nahtlos in die „autobiografischen“ Texte von Bernhard ein. Der Ich-Erzähler Thomas Bernhard, den ich vom Autor Thomas Bernhard doch unterscheiden will, berichtet vor allem über die Geschehnisse rund um jene Literaturpreise, die ihm vor allem für „Frost“ zugedacht wurden. Der Autor gibt damit Einblick in die literarisierten Befindlichkeiten seiner Figur Thomas Bernhard der 60er Jahre und den so genannten deutschsprachigen Kulturbetrieb.
Einiges aus „Meine Preise“, das so um 1980 entstanden sein dürfte, ist dem Publikum bereits seit Jahren bekannt. Bernhard verarbeitete die Geschichte um den Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bereits in „Wittgensteins Neffe“ erzählte, wenn auch etwas anders erzählt. Zwei Fassungen derselben Begebenheit dürfte nicht nur für eingefleischte Bernhard-Fans eine Empfehlung sein. Ein weiterer Unterschied zu anderen biografischen Werken ist augenscheinlich: Bernhard bezeichnet seine Entourage immer nur mit dem Begriff „Freunde“. Die einzige Person aus seinem direkten Umfeld, die Bernhard explizit erwähnt und die neben dem Ich-Erzähler Thomas Bernhard die zweite „Figur“ dieses Buches darstellt, ist jene Tante, die in der Wiener Obkirchergasse wohnte und Thomas Bernhard ein ständiger Rückhalt war.
Neben der Literaturpreisthematik, die in der Belletristik wohl eher selten besprochen wird, präsentiert sich der Ich-Erzähler als personifizierter Widerspruch mit einer Beständigkeit eines emotionalen Pingpongballs. Man/frau könnte ihn auch mit „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“ charakterisieren. Immer wieder betont der Ich-Erzähler Thomas Bernhard, wie er die Preise hasse, dabei gibt es einige, die er sogar gerne entgegen nimmt, wie zum Beispiel den Julius-Campe-Preis, der an keinerlei Zeremonie gebunden war. Eine Konstante bleibt jedoch bei allen Preisen und Zeremonien: Bernhard stellt sich als kurzer Redenschreiber vor, der es versteht das anwesende Publikum in ihren Erwartungen zu enttäuschen. Weniger vorsichtig ausgedrückt: Bernhard provoziert in seinen Reden. Der Fall Piffl ist je bereits Legende. Dankenswerterweise wurden einige im Anhang abgedruckt.
Der „Übertreibungskünstler“ Bernhard festigt in diesem Text nachhaltig sein Image als Individualist und als Getriebener, als Außenseiter, der nirgends dazu gehören will, der literarische oder andere Vereinigungen hasst, ohne dem Geselligen abgeneigt zu sein. Er präsentiert sich als jemand, der es den anderen schwer macht, ihn zu mögen, der andere schnell be- und verurteilt und sich darüber aufregt, dass selbiges – vor allem in der Medienlandschaft – mit ihm gemacht mit. Die Passage über George Saiko ist diesbezüglich selbstredend. Ein widersprüchlicher Bernhard, der zwischen Geldnot und Dandytum hin- und herpendelt, der einerseits als Bierauslieferer arbeitet und vollkommen glücklich zu sein scheint, andererseits sein Glück in einem weißen Triumpf Herald sieht, mit dem er nach Ungarn und Jugoslawien fährt. Stellenweise ist Thomas Bernhard in dieser Widersprüchlichkeit absolut amüsant (zu lesen). Nebenbei erweist er sich als Meister der eleganten Abschweifung. Einzelne Preisverleihungen dienen dazu ganz andere Geschichten zu erzählen. Auf Seite 101 zieht er eine Art Resumé von „Meine Peise“: „(…)Aber ich war doch die ganzen Jahre, in welchen noch Preise auf mich zukamen, zu schwach, nein zu sagen. Hier hat, so dachte ich immer, mein Charakter ein großes Leck. Ich verachtete die, die die Preise gaben, aber ich wies die Preise nicht strikt zurück. Es war alles widerwärtig, aber am widerwärtigsten empfang ich mich selbst. Ich haßte die Zermoniere, aber ich macht sie mit, ich haßte die Preisgeber, aber ich nahm ihre Geldsummen an.“ und an anderer Stelle (Seite 72) „Ich bin nicht gewillt, fünfundzwanzigtausend Schilling abzulehnen, sagte ich, ich bin geldgierig, ich bin charakterlos, ich bin selbst ein Schwein.“
geschrieben am 11.02.2009 | 766 Wörter | 4743 Zeichen









Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen