Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Der Russland-Komplex - Die Deutschen und der Osten 1900-1945
| ISBN | ||
| Autor | Gerd Koenen | |
| Verlag | C.H.Beck | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 528 | |
| Erscheinungsjahr | 2005 | |
| Extras | gebundene Ausgabe |
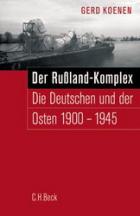
Rezension von
Max Bloch
Gerd Koenen, als langjähriger Mitarbeiter Lew Kopelews ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der deutsch-russischen Beziehungen, hat mit seiner Darstellung des deutschen „Russland-Komplexes“ eine Art „Gegenperspektive“ zu Heinrich August Winklers „Weg nach Westen“ eröffnet. Und gleichzeitig hat er, nachdem der „Historikerstreit“ bereits selbst historisch geworden ist, das Verhältnis zwischen Bolschewismus und Nationalsozialismus aus einem allzu abstrakten Aktion-Reaktion-Schema (Stichwort: „kausaler Nexus“) herauszulösen und den Blick auf das tatsächlich „komplexe“ Beziehungsgeflecht zu lenken versucht, das das deutsch-russische Verhältnis zwischen 1900 und 1945 (und darüber hinaus) prägte. Dabei wirft er sich aber nicht in die beckmesserische Pose eines Anti-Winkler oder Anti-Nolte, sondern möchte er durch seine gehaltvolle Studie einen Beitrag zur Relativierung allzu schlüssiger Geschichtsdeutungen leisten.
weitere Rezensionen von Max Bloch

Vor allem die Person des liberalen Reiseschriftstellers Alfons Paquet, der in den Wirren der Oktoberrevolution der Faszination des bolschewistischen Experimentes sukzessive erlegen ist, dient Koenen als Folie jener diffusen „Mischung aus Anziehung und Abstoßung“, die von Ernst Nolte bereits auf den Begriff einer „feindlichen Nähe“ gebracht worden ist. Die Finanzierung der Bolschewiki durch das wilhelminische Kaiserreich, in deren Zentrum die Figur des marxistischen Millionärs Parvus-Helphand stand, werden aus dem Reich des Abenteuerlich-Verwitterten in den Kontext der oft widersprüchlichen deutsch-russischen Beziehungen gestellt, die vor allem in Folge der alliierten Friedensbedingungen 1919 als eine Art Gegenblock zu den „imperialistischen“ Mächten des Westens herhalten sollten. Das Phänomen des so genannten „Nationalbolschewismus“ hatte hier seinen Ursprung. Selbst im nationalsozialistischen Lager waren die Sympathien für Sowjetrussland Legion, und Adolf Hitler hatte alle Mühe, die außenpolitischen Vorstellungen eines Gregor Strasser oder Joseph Goebbels in seiner Partei zu isolieren. Indem er den Primat der Innenpolitik wiederherstellte, habe Hitler, so Koenen, gegenüber seinen innerparteilichen Gegnern „realpolitische“ Qualität bewiesen.
Koenen arbeitet überzeugend heraus, dass eine grassierende Bolschewistenfurcht (selbst im rechten Lager) kaum bestand und infolgedessen nicht als Grundbedingung der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik während des Zweiten Weltkrieges herhalten könne. Zum Abschluss der anregenden Lektüre wird dem Leser noch ein Ausblick auf die deutsch-russischen Beziehungen nach 1945 geliefert. Die neutralistischen Bewegungen von links und rechts, die (An-)Klagen über eventuell „verpasste Chancen“, die blinde Russophilie der Friedensbewegung werden von Koenen in jene Traditionen eingebettet, die dem „Westen“ gegenüber stets skeptisch gestimmt waren und vom „Osten“ das Licht erwarteten. Koenens abschließende Bewertung, erst 1990 hätte Deutschland seinen Ort im „Westen“ letztgültig gefunden, bleibt in ihrer prognostischen Verbindlichkeit jedoch fraglich. Gerade in jüngster Zeit deutet sich unter dem Schirm eines alt-neuen Antiamerikanismus eine neue Zuwendung gen Russland an, die Erinnerungen an alte „Schaukelpolitiken“ weckt. Wenn amerikanische Defensivsysteme als bedrohlicher empfunden werden als russische Bombendrohungen, so scheint der „Weg nach Westen“ einmal mehr zu stocken.
geschrieben am 18.07.2007 | 422 Wörter | 3054 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen