Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Grenzenlose Gaumenfreuden
| ISBN | 3805342411 | |
| Autor | Jutta Meurers-Balke | |
| Verlag | Zabern | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 168 | |
| Erscheinungsjahr | 2010 | |
| Extras | - |
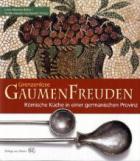
Rezension von
Anna Kneisel
Zu den Herausgeberinnen:
weitere Rezensionen von Anna Kneisel

Dr. Jutta Meurers-Balke leitet das Labor für Archäobotanik des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln. Sie ist Herausgeberin von „Obst, Gemüse und Kräuter Karls des Großen“(2008), sowie von „Grenzenlose Gaumenfreuden: Römische Küche in der germanischen Provinz“ (2010).
Dr. Tünde Kaszab-Olschewski ist Archäologin mit dem Schwerpunkt provinzial-römische Archäologie und lehrt an der Universität Köln.
Zum Titel:
„Grenzenlose Gaumenfreuden“ entstand aus Ermangelung entsprechender Literatur, die beispielsweise Studenten als Quelle für Referate etc. über die Küche der Römer und die damalige Ernährung im Allgemeinen hätten verwenden können. Außerdem steht es in Verbindung mit einer Ausstellung gleichen Namens. Zu den wissenschaftlichen Ausführungen wurden passende Ausschnitte aus dem antiken Kochbuch „De re coquinaria“ von Apicius hinzugefügt, jeweils im lateinischen Original und einer deutschen Übersetzung daneben. Diese Ausschnitte sind leicht zu finden, da man sie farblich gut hervorgehoben hat und sie sind immer zu den entsprechenden Lebensmitteln sortiert.
Behandelt werden die verschiedensten Lebensmittel sowohl pflanzlicher, als auch tierischer Natur, sowie Gewürzpflanzen – nicht nur, wie sie verwendet wurden, sondern auch, wo sie herkamen, wie sie ihren Weg in hiesige Gefilde und auf die Teller der antiken Menschen nahmen und welche Bevölkerungsgruppen vor allem in ihren Genuss kamen.
Dabei stellt man fest, dass viele Nahrungsmittel, die heute für uns alltäglich sind, beispielsweise die Zwiebel, zur Zeit der Römer Luxusgüter waren, während andere heute nicht mehr klar zu identifizieren sind und auch schon in der antike schwer zu bekommen waren, beispielsweise „silphion“, auch unter dem Namen „laser“ bekannt, der später durch Asant (assafoetida) ersetzt werden musste.
Den heutigen Europäer mag es auch erstaunen, dass Milch damals, wenn, dann eigentlich nur als Abführmittel getrunken wurde, aufgrund der verbreiteten Laktoseintoleranz. Die Herstellung von Käse jedoch hat sich bis heute in ihren Grundzügen kaum verändert: anhand von Überresten konnte eine Schale rekonstruiert werden, mit der man Käse herstellte und diese in Form von experimenteller Archäologie nachvollzogenen Arbeitsschritte kann der geneigte Leser auf Bildern begutachten.
Allerdings erfährt man nicht nur etwas über die Erkenntnisse der Archäologie, Archäozoologie und Archäobotanik, sondern auch, wie die Forscher diese gewinnen konnten, also aus Grabbeigaben, Brunnen und ähnlichen Quellen. Die im Untertitel genannte germanische Provinz, die als Beispiel für die römische Küche dienen soll, ist in diesem Fall näher einzugrenzen auf Köln, bei den Römern unter dem Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium bekannt, und das Umland.
Die Römer waren keine Kostverächter – sie genossen es, die unterschiedlichsten Speisen zu sich zu nehmen und scheuten auch nicht davor zurück, diese mit einem Abbild ihrer Selbst in Stein zu meißeln. Wer und wann, wo, was? Diese Fragen beantworten die Autoren systematisch, informativ und detailliert, bevor sie schließlich noch ein Kapitel den Auswirkungen des römischen Erbes auf die heutige Zeit widmen.
Ein ausführlicher Anhang mit einer Liste antiker Autoren von Ausonius bis Xenophon sowie Literaturnachweisen und Bildnachweisen vereinfacht das Nachschlagen und Arbeiten mit diesem Band. Wer hier Informationen sucht, wird fündig werden – ein wirklich hilfreicher, durchdachter Beitrag zur Literatur über römische Küche in Germanien.
geschrieben am 28.09.2010 | 491 Wörter | 3129 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen