Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Aristoteles in Oxford: Wie das finstere Mittelalter die moderne Wissenschaft begründete
| ISBN | 3608948546 | |
| Autor | John Freely | |
| Verlag | Klett-Cotta | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 395 | |
| Erscheinungsjahr | 2014 | |
| Extras | - |
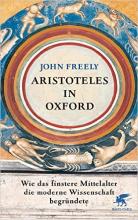
Rezension von
Hiram Kümper
John Freely ist kein Historiker, kein Philosoph – nein, eigentlich ist er Physiker. Trotzdem schreibt er über das Mittelalter. Und sein Buch ist eine Freude.
weitere Rezensionen von Hiram KĂĽmper

Dass das Mittelalter mitunter gar nicht so finster war, wie der Volksmund will, das ist trotz aller Beteuerungen noch nicht in allen Ecken populärer Geschichtsbildes angekommen. Freelys Buch unternimmt es nun, das (wieder einmal) zu ändern. Und sein Ansatzpunkt ist ein sehr einleuchtender: die europäische Universität des Mittelalters. Die hat in den letzten Jahrzehnten – Bologna-Prozess sei Dank – wieder eine gewichtige Rolle auch im politischen Diskurs gespielt, ist nämlich zum gern genutzten Argument für die Segnungen der Studienreformen geworden. Dass dieses Bild einer europaübergreifenden, hoch mobilen Gelehrten- und Studierendenkultur gehörig verzerrt ist, steht auf einem anderen Blatt. Freely ruft solche Holzschnitte zum Glück nicht wieder auf; tut aber auch nichts, sie zu wiederlegen. Ihn interessieren nicht so sehr die Strukturen, ihn interessieren die Denker und was sie dachten.
Und so ist die mittelalterliche Universität und ihr Umgang mit dem aristotelischen Erbe nur der Start- und immer wieder aufgerufene Ankerpunkt für einen Parforceritt durch die europäische Wissenschaftsgeschichte, insbesondere die Geschichte der Naturwissenschaften. Völlig zu Recht und mit großer Kenntnis betont Freely die Vermittlerfunktion der arabischen Gelehrtenwelt, die er in einem anderen, komplementären Buch („Platon in Bagdad“, ebenfalls 2014 in deutscher Übersetzung bei Klett-Cotta erschienen) noch ausführlicher behandelt hat. Diesmal steht aber deutlich die europäische Wissenschaftsgeschichte im Mittelpunkt der Betrachtung: Über Oxford und Paris, die dominikanischen Studia und die aufstrebenden Universitäten Mitteleuropas, über Kopernikus und Galilei, hetzt er den Leser geradezu weiter bis zu Newton und Descartes.
Manchmal bleibt dabei der Faden auf der Strecke und begnügt Freely sich mit allzu oberflächlichen, geradezu lexikalischen biographischen Abrissen. Das ist schade. Denn immer da, wo er die Personen, die ihm als Mittler von Gedanken doch so wichtig sind, verlässt und sich ganz auf ihre Lehren und Erkenntnis einlässt, wird er zu einem spannenden, dichten Erzähler, der zeigt, wie sich Gedanken ausdifferenzieren, diffundieren, dispersieren, ja mitunter durch die Gelehrtenwelt Europas geradezu mäandern und dann erst später wieder von anderen aufgegriffen und weitergeführt werden. Das ist anregend, lehrreich und unterhaltsam zugleich. Dagegen wirken die vielen eingesprenkelten biographischen Informationen mitunter etwas gezwungen und ohne Rückbindung an den Fluss der Erzählung.
Eines ist deutlich spürbar an diesem Buch: Es hat eine Mission. Und das muss man als Leser billigen und sich – ganz gleich, ob kritisch oder affirmativ – damit auseinandersetzen. Freely, der an der Universität Istanbul gelehrt hat, hat sein Buch gleichsam selbst gelebt. Er ist personifizierter Kulturaustausch im akademischen Milieu. Dass er dabei programmatisch wird, mitunter vielleicht auch zur Überbetonung neigt, kann ihm niemand verübeln. Es ist ein optimistisches Bild, das er uns da vorlegt, eines, das von dem unerschütterlichen Glauben ausgeht, Wissen ließe sich weder durch politische noch durch religiöse Einflussnahme und Vorbehalte letztlich aufhalten. Diesen Optimismus muss man nicht teilen. Aber wäre es nicht schön, wenn Freely am Ende Recht behielte?
geschrieben am 18.10.2015 | 483 Wörter | 3019 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen