Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
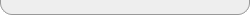
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Perspektiven, Bd. 6: Rudi Dutschke. Revolutionär im geteilten Deutschland
| ISBN | 3935063067 | |
| Buchreihe | Perspektiven | |
| Autor | Bernd Rabehl | |
| Verlag | Edition Antaios | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 132 | |
| Erscheinungsjahr | 2002 | |
| Extras | - |
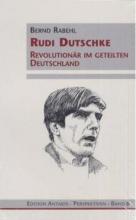
Rezension von
Daniel Bigalke
Der RevolutionĂ€r verlĂ€Ăt die âLitanei von Frage und Antwort unserer Medien (..) und politischen Wissenschaft, die Kritik nur simulieren, weil sie ohne Konsequenzen bleibtâ - so schrieb Bernd Rabehl jĂŒngst in einer Kolumne. Auch er möchte damit den leidenschaftslosen Historismus der akademischen Zunft ĂŒberwinden und macht diesen Anspruch anhand der Perspektive Rudi Dutschkes (1940-1979) deutlich. Seine befehdete Studie bricht aus dem gewohnten Intelligenzbetrieb aus und beschreibt das Aufbegehren der Studenten von 1968. Zu Beginn macht Rabehl, bis 2003 Professor fĂŒr Politikwissenschaft an der FU Berlin und einstiger WeggefĂ€hrte Dutschkes, deutlich, daĂ es ihm nicht um eine Biographie geht, sondern darum, Dutschkes Denken im Sinne umfassender Neureflexion (Kapitel 5: âNeubesinnenâ) aus den âhistorischen ZusammenhĂ€ngen heraus zu entschlĂŒsseln.â (7).
weitere Rezensionen von Daniel Bigalke

Die deutsche Nachkriegsdemokratie geriet 1968 durch Anklage in die Grundlagenkrise. GemÀà dem idealistischen Anspruch einer Konvergenz von Sollen und Sein verkĂŒndete Herbert Marcuse das Ende der Trennung des Ăsthetischen vom Wirklichen. Die AufklĂ€rung sei nur halb vollendet, und es klaffe eine irrationalistische LĂŒcke zwischen freiheitlichen Proklamationen und den durch die PrĂ€rogativen des Besatzungstatuts vorgegebenen ökonomistischen Grundprinzipien der Bundesrepublik. So reicht bei Marcuse der Affekt gegen den verkĂŒrzten Rationalismus einer negativ bleibenden AufklĂ€rung bis zur hegelschen Ăsthetik und zum Vernunftidealismus Kants zurĂŒck. Im Zuge dieser Tendenzen macht Rabehl deutlich, daĂ die Studenten an ihrer Radikalisierung scheitern muĂten und sich zu den Sachwaltern der halben RationalitĂ€t hin konformisierten (102ff.).
In Kapiteln wie âBesetzung und Befreiungâ (32ff.) oder âRevolteâ (58ff.) wird deutlich, daĂ sogar fĂŒr Dutschke nach 1945 die Deutschen zu den geschichtslosen Völkern gehörten (109), womit die Deutsche Ideologie nach der Wiedervereinigung - fĂŒr Politologen wie Bernard Willms oder Hans-Joachim Arndt war das keine Ăberraschung - primĂ€r den nordamerikanischen Prinzipien folgte. Theoretische Abweichungen konnten nunmehr im Rahmen herrschaftsaffirmativer und staatlich alimentierter Politologie als âExtremismusâ (8) kategorisiert werden. Rabehl, selbst Opfer dieser Denunziationen geworden, weiĂ, daĂ kein Versuch unternommen wurde, das PhĂ€nomen des traditionellen deutschen Politikbegriffes, so beispielsweise seinen politischen Idealismus, die AprioritĂ€t der Vernunft und der Pflicht, die bei Hegel angelegte Reflexionstheorie oder die PhĂ€nomenologie menschlichen Geistes, aus sich selbst heraus zu erfassen. Die Rekonstituierung deutscher Staatlichkeit blieb nachhaltig um das Element der Jeweiligkeit, der eigenen deutschen Teilwahrheit, beschnitten. Die StĂ€rke von Rabehls Buch liegt darin, daĂ es die reformierte Idee einer Dialektik der Freiheit, eines geradezu permanenten Gestaltungsauftrags - man erinnere sich an Artikel 146 des Grundgesetzes - am GlĂŒhen erhĂ€lt. Es vermag deshalb konservative Aspekte im Sinne einer staatsphilosophischen KontinuitĂ€t erstmals bei Dutschke zu erkennen. Das Agieren der Parteien ĂŒber inszenierte WerbefeldzĂŒge und die politische Tendenz zur systemimmanenten Stagnation als faktischer Reproduktion des ewig Gleichen lieĂen Rudi Dutschke patriotische Konsequenzen ziehen. Seine revolutionĂ€ren Motive speisten sich aus der Ablehnung dekretierter Besatzungspolitik. Rabehl lĂ€Ăt - wie einst 1968 - immer noch Funken sprĂŒhen.
Der Leser mag selbst entscheiden, ob er im Gesamtkontext des Buches die autobiographischen Exkurse Rabehls ĂŒber seine in MĂŒnchen gehaltene Dutschke-Rede von 1998 oder die Abrechnung mit dem âKartell der LĂŒgenâ (119), das GerĂŒchte ĂŒber sich selbst und Dutschke verbreitet haben soll, fĂŒr hinderlich hĂ€lt. Rabehls PlĂ€doyer fĂŒr den erneuten Versuch einer Staatspartei jenseits der in die Dominanzstrukturen des hegemonialen Pseudodiskurses eingebetteten âVolksparteienâ wird nur vor folgendem Hintergrund deutlich: Nation war fĂŒr Dutschke - entgegen den Biographen Christian Dithfurth oder Gretchen Dutschke - eine Instanz des Freiheitskampfes. Rabehl gibt zu: âPlötzlich wurde ich von auĂen in das Denken von Dutschke gestoĂen, und erst jetzt begriff ich seinen revolutionĂ€ren Ansatz.â Das Buch verdeutlicht also, daĂ der Sinn einer politischen Ordnung nicht die Tautologie ihrer alleinigen Existenz ist, sondern das Gemeinwohl. Rabehls Schrift, die sich von der ĂŒblichen Begriffsbildung einseitiger WahrheitsansprĂŒche abhebt, entwickelt MaĂstĂ€be, von denen nicht zuletzt die heutige politische Wissenschaft profitieren könnte.
Till Kinzel: Nicolås Gómez Dåvila. ParteigÀnger verlorener Sachen, Band 7 der Reihe Perspektiven, Edition Antaios Schnellroda, 2003, 154 S.
Einer jeden Wissenschaft zu entrinnen, war das Anliegen NicolĂĄs GĂłmes DĂĄvilas (1913-1994), wenn er in seinen 1954 verfaĂten âNotasâ - erstmals 2005 in deutscher Sprache veröffentlicht - schreibt: âDen starren Koordinaten der Wissenschaft wie der UnterdrĂŒckung durch die kollektiven Mythen zu entgehen, ist die GegenwĂ€rtige Aufgabe des Geistes.â Wer war dieser Mann, der provokant die Aufgabe des Geistes jenseits der Wissenschaft sieht und die Denunziationsvokabel âReaktionĂ€râ (el reaccionario) zum Ehrentitel modifizierte? Die Schrift von Till Kinzel - bisher die einzige Monographie ĂŒber DĂĄvila - gibt AufschluĂ.
DĂĄvila war Meister der aphoristischen Verknappung, er war der kolumbianische Nietzsche. Kinzel ist in seinem Buch bemĂŒht, alle notwendigen ZusammenhĂ€nge seines Denkens authentisch darzustellen und muĂ sich dafĂŒr einem permanenten Hagel an geschliffenen Gedanken, einem quasi-literarischen Stahlgewitter stellen, welches Ausdruck Ă€sthetischer und ethischer Greuel ĂŒber die moderne Gesellschaft ist. DĂĄvila, angesehen in der Gesellschaft von BogotĂĄ und jeglicher Inkorporartion in politische Ămter, die man ihm oft anbot, abhold, weilte viele Jahre im Kreise seiner Familie innerhalb seiner Bibliothek. Vor diesem âherzlichâ anmutenden Hintergrund verdeutlicht Kinzel den Kampf DĂĄvilas gegen das âProblem der wuchernden sekundĂ€ren Diskurseâ (18), die das Wesentliche im Leben verbergen, um sich dann auf das literarische PhĂ€nomen dieses merklich theologisch orientierten Denkers zu konzentrieren (27ff.). Gott war fĂŒr DĂĄvila der Kern der Dinge, von dessen Gnade der Mensch nur erhoffen könne, was er sich nicht selbst anmaĂen dĂŒrfe. In seiner Ablehnung der VulgaritĂ€ten des Tages, der Moderne ĂŒberhaupt, ist DĂĄvila nur vergleichbar mit dem spanischen GegenaufklĂ€rer und âReaktionĂ€râ des 18. Jahrhunderts - Juan Donoso CortĂ©s.
Hier wird deutlich, daĂ auch das terminologische Konstrukt âReaktionĂ€râ bei wertfreier Betrachtung bereits eine variierende ModalitĂ€t in sich birgt. âReaktionĂ€râ ist nicht gleich âReaktionĂ€râ. Kinzel begibt sich hier - womöglich unbeabsichtigt - in die kantische Dialektik von umfassend empirisch reflektierten Erfahrungsurteilen, die objektive Geltung beanspruchen können, und lediglich subjektiv motivierten Wahrnehmungsurteilen, die deshalb wenig objektive Geltung beanspruchen dĂŒrfen. Wahrheit liegt in Abwandlung der kantischen transzendentalen Dialektik nicht in den Dingen selbst â hier in dem Begriff âReaktionĂ€râ - sondern in der dem Worte jeweils subjektiv zugeschriebenen Bedeutung, also in dem Urteil ĂŒber das Wort, sofern es gedacht wird. Dieses Urteil muĂ deshalb möglichst rechtschaffen und an der Empirie orientiert sein, um sich von ihr nicht zu entkoppeln. Es wird dann zum Erfahrungsurteil. Terminologische Bedeutungen variieren je nach individueller Wahrnehmung. Kinzel hingegen bedient sich Botho StrauĂâ als eines Kronzeugen: Der ReaktionĂ€r sei nicht RĂŒckschrittler - man könnte ergĂ€nzen: zu dem ihn die maĂgeblich von der Empirie entkoppelten Wahrnehmungsurteile und Herrschaftsstrukturen machen - sondern er schreitet voran, etwas Vergessenes zu revitalisieren. So gerĂ€t Kinzels Buch zugleich zu einer PhĂ€nomenologie des âReaktionĂ€rsâ, der je nach Motivation des Urteils variabel definiert werden könne, ein realistisches Bild vom Menschen habe und davor gefeit sei, einer utopischen Restauration des Verlorenen zu verfallen. Er bleibt Richter ĂŒber die Dinge und gibt seinen Geist niemals der PartialrationalitĂ€t temporĂ€rer Ideologien preis. Er schreitet voran. War DĂĄvila niemals um eine wachsende Leserschaft bemĂŒht, so ist doch dem Buche Kinzels eine groĂe Verbreitung zu wĂŒnschen. Setzte DĂĄvila als Verfechter eines Schreibstils, der keiner formalistischen Gattung beizuordnen ist, auf das Pathos der Distanz zur VulgaritĂ€t des politischen Alltags, so kann gerade die zunĂ€chst inhaltliche Distanz des gegenwĂ€rtigen Lesers die eigentliche Voraussetzung zum ertragreichen VerstĂ€ndnis DĂĄvilas sein. DĂĄvila hĂ€tte im Sinne seiner âNotasâ dazu angemerkt: âLesen heiĂt einen StoĂ erhalten, einen Schlag spĂŒren, auf ein Hindernis treffen.â
geschrieben am 16.11.2006 | 1157 Wörter | 7890 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen