Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
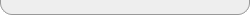
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Weniger sind mehr
| ISBN | 3593382709 | |
| Autor | Karl Otto Hondrich | |
| Verlag | Campus | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 280 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag |

Rezension von
Christoph Kramer
Karl Otto Hondrich vertritt in seinem jüngsten Buch einen systemtheoretisch grundierten Neomalthusianismus. Sein grundlegendes Argument lautet, daß sich der Geburtenrückgang aus der Selbststeuerung sozialer Systeme erkläre und sich daher einer politischen Regulierung weitgehend entziehe.
weitere Rezensionen von Christoph Kramer

Für die „alarmistischen“ Argumente der derzeitigen Demographie-Debatte zeigt Hondrich wenig Verständnis und versucht sie der Reihe nach zu entkräften. Dabei wiederholt sich immer wieder das Hondrichsche Grundmuster: mehr Qualität durch weniger Quantität. Dies will er sogar global verstanden wissen. Tatsächlich sei ein epochaler Bruch zu erkennen: „Die menschliche Spezies, zunächst quantitativ überaus erfolgreich, hat selbst einen Umschlag von der Quantität in der [sic] Qualität erfahren. So etwas ist meines Wissens von keiner anderen Lebensart bekannt.“
Für die Wirtschaft beispielsweise sei der Bevölkerungsrückgang ein Glücksfall, weil ihm eine steigende Produktivität korrespondiere. Der angeblich drohende Angebotsrückgang aufgrund fehlender Arbeitskräfte könne problemlos durch „importierte Arbeitskräfte“, höhere Frauenerwerbsquote, verlängerte Tages-, Wochen- und Lebensarbeitszeiten sowie gesteigerte Arbeitsproduktivität vermieden werden. Gerade das Aufsaugen gut gebildeter Frauen durch den Arbeitsmarkt werde die Geburtenrate in Zukunft eher noch weiter senken. Hohe Löhne, Lohnnebenkosten und Steuern seien zu begrüßen, weil sie den Unternehmer dazu zwingen, die Produktivität zu steigern und damit effizienter zu wirtschaften. Auch den Befürchtungen eines Rückgangs des Konsums durch Überalterung tritt Hondrich mit dem Argument entgegen, daß sich ja lediglich „Art und Muster“ des Konsums bei älteren Menschen verändere. Ein neuer Nachfrageboom nach Gesundheits- und Pflegeleistungen werde die Konsumschwäche locker aufwiegen. Daß das Geld für diese Nachfrage aus den laufenden Beiträgen der Jüngeren kommt, erwähnt Hondrich, sieht darin aber kein Problem, wie sich anhand seiner Ausführungen zum Sozialstaat gleich zeigen wird.
Für das System der sozialen Sicherung sei der Bevölkerungsrückgang nämlich auch ein Glücksfall – zunächst, weil weniger Kinder eine Entlastung desselben darstellten. Der Sozialstaat ruhe außerdem nicht auf der Anzahl der Arbeitenden, sondern auf den beiden Pfeilern der „Produktivität“ und der „Solidarität“ der Arbeitenden (wenn es auch wenige sind) mit der nichtarbeitenden Bevölkerung. Sollten die hochproduktiven Arbeitskräfte wirklich einmal nicht mehr reichen, könne das System ja noch stärker auf Frauen und „Fremde“ ausweichen. Auf diese Weise würden sich die Systeme sozialer Sicherung ganz gut selbst regulieren können – wenn ihnen nicht das politische System im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung böse „ins Rad“ gegriffen und ein „Zuviel“ an Solidarität eingefordert hätte. Angesichts dieser Lage befürwortet Hondrich Teilprivatisierungen der sozialen Sicherungssysteme, Kürzungen bei den Leistungsempfängern und weitere Beitragserhöhungen bei den Leistungsträgern, die dies durch Produktivitätssteigerungen finanzieren sollen. Merke: Je höher die Produktivität und je höher entsprechend die Löhne steigen „desto mehr kann auch für die Rentner, Kranken, Jugendlichen abgezweigt werden.“ Zudem könnten billige Waren und Dienstleitungen aus Niedriglohnländern den hiesigen Transferempfängern auch bei sinkenden Sozialleistungen den gleichen Lebensstandard sichern. Hondrich bekennt offen: Wenn Leute hierzulande ihren Arbeitsplatz verlieren und dafür in der Dritten Welt andere aus tiefer Armut aufsteigen, könne man darin „eine Art global ausgleichende Gerechtigkeit“ sehen, schließlich hätten „wir Bürger der Industrienationen kein verbrieftes Recht darauf, immer älter zu werden, zugleich weniger zu arbeiten und den Wohlstandsvorsprung gegenüber den nachrückenden Gesellschaften zu halten.“
Für das „System der Familie“ sei der Bevölkerungsrückgang ebenfalls ein Glücksfall, weil – je weniger Familienmitglieder desto intensiver – ihr „Leitwert“ der „Liebe“ nun besonders gut zur Geltung käme und sich damit die familiale Qualität erhöhe. Zwar sei eine Verringerung der Zahl der „Kernfamilien“ (zwei Eltern – zwei Kinder) zu erwarten, aber dafür vergrößere sich die Zahl anderer Familienformen (zu denen zählt Hondrich Patchworkfamilien, Homosexuellenfamilien, „Freundesfamilien“ von Wahlverwandten uvm.), in denen familiale Qualität gelebt werden kann – auch ohne Kinder. Diejenigen Paare, die trotz aller tatsächlichen Kosten und „Opportunitätskosten“ (Verzicht auf andere Optionen) noch Kinder bekommen, zeichneten sich gerade dadurch als die besseren Familienmenschen aus, so daß auch die Erziehungsqualität steige. Gegen Phillip Longmans Argument, daß sich gerade die kulturellen Muster der patriarchalischen Großfamilie aufgrund deren größerer Kinderzahl gegenüber liberal-egalitären Modellen mit weniger bis keinen Kindern sozusagen auf genetischem Wege durchsetzen werden, behauptet Hondrich, daß aus dem großen Kinder-Reservoir der Großfamilien wiederum Kleinfamilien entstehen werden – daß sich also die Kleinfamilie durch soziokulturelle Evolution statt durch biologische Reproduktion behaupten werde.
Auch für den „Kampf der Kulturen“ sei der Bevölkerungsrückgang ein Glücksfall, weil die kindereichen Kulturen darauf brennen würden, „ihre Kinder in den produktiven Teil der Welt mit seinen hervorragenden soziokulturellen Problemlösungen zu entsenden“. Auf diese Weise könnte der Westen in einer Art „internationale Aufgabenteilung“ die Reproduktion der eigenen Lebensformen „outsourcen“. Solche Arbeitsteilung meint Hondrich für etwa 100 Jahre veranschlagen zu können, bis sich weltweit alle Kulturen auf das westliche Reproduktionsmodell umgestellt hätten. (Hondrich benutzt hier u.a. eine Metapher aus der Biologie, indem er einen weltweiten Übergang von der „r-Strategie“ (viele Nachkommen, kurze Lebenserwartung) zur „k-Strategie“ (wenig Nachkommen, lange Lebenszeit) prognostiziert. Er sieht einen Wettlauf der „Ausbreitungsgeschwindigkeiten“ zwischen nichtwestlichen Kulturen mit hohen Geburtenziffern und der westlichen Kultur mit ihren „überlegenen Problemlösungen und Werten“. Letztlich ist er aber zuversichtlich, daß sich das westliche Kulturmuster (z.B. der Familie mit wenigen, aber hochgradig wertgeschätzten Kindern und dem Ideal der Liebesehe) durchsetzen werde. Er bringt hier das klassische Argument, daß mit den Errungenschaften des Westens (Waren, Waffen, Wissen) auch gleichzeitig dessen Werte (Frauenemanzipation, Liebesehe und Wunschkind) unweigerlich mitgeliefert würden.
Hondrich pflichtet Huntington insofern bei, daß es tatsächlich einen „Kampf der Kulturen“ gebe. Kulturell-religiösen Erklärungen steht Hondrich allerdings ablehnend gegenüber. Die besondere Gewalttätigkeit islamischer Kulturen des Vorderen Orients erkläre sich nicht aus deren spezifischer Kultur, sondern vielmehr daraus, daß sie der „kulturellen Verwestlichung“ und militärischen Präsenz des Westens (die übrigens an keiner Stelle grundsätzlich kritisiert wird) besonders unmittelbar ausgesetzt seien und zudem für die „mehrheitlich jugendliche Bevölkerung“ die Versprechungen des Westens auf bessere Lebenschancen weitgehend unerfüllt geblieben sind. In ähnlicher Weise argumentiert er auch hinsichtlich der muslimischen Jugendlichen in Europa. Diese und andere Einwanderer zu Trägern der westlichen Kultur zu machen, darin sieht er mit Volker Gerhardt sogar eine „weltpolitische Sendung des alten Europa“ – allerdings mit der Einschränkung, daß die Einwanderung quantitativ und qualitativ so zu lenken sei, daß die Aufnahmeländer von der Integrationsaufgabe nicht überfordert werden. Dennoch könne nicht erwartet werden, daß die „aufnehmende Kultur“ bei der Akkulturation „ungeschoren“ davonkäme.
Hondrich entfernt sich also denkbar weit vom Huntingtonschen Konzept der Selbstbescheidung des Westens und nähert sich eher den Denkmustern der sogenannten „Neocons“ an. Islamismus und Terrorismus seien lediglich „negative Gegenbewegungen auf dem Weg zur Weltgesellschaft“.
Für das einzelne Individuum sei der Bevölkerungsrückgang ein Glücksfall, weil dadurch die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Lebensentwürfen erweitert wurde und wird. Konservative Aufrufe, die eine ethische Pflicht zur Elternschaft einfordern, hält Hondrich für absolut fruchtlos, da sich die Kultur des Individualismus unwiderruflich durchgesetzt habe.
Zwar sei der Geburtenrückgang auch verbunden mit der Freiheit selbstbestimmter Individuen, aber dem kinderlosen Individuum dürfe man keinesfalls eine individuelle Schuld zuweisen, schließlich sei es die Gesellschaft, die keine Kinder hervorbringe, weil sie gesellschaftlich nun einmal nicht gebraucht würden. Die Populationsregulierung geschehe dabei größtenteils unbewußt, wie bei „Tieren“.
Wenn die Politik in die Selbststabilisierung anderer Systeme einzugreifen versucht, könne das unerwünschte Folgen haben. „Kindersubventionen“ und Umleitung von Mitteln aus anderen Sozialsystemen in die Familie hält Hondrich für falsch, weil sie erstens keine Effekte erzielten und zweitens, selbst wenn sie zu einem Geburtenanstieg beitrügen, womöglich ungewünschte Nebeneffekte produzierten. So erklärt Hondrich etwa die brennenden Autos in den französischen Vorstädten mit der erfolgreichen französischen Geburtenpolitik, die nun aber eine hohe Jugendarbeitslosigkeit zur unerwünschten Folge habe.
Die derzeitigen Demographiedebatten hätten auf die Geburtenentwicklung jedenfalls keinerlei Einfluß – ihre Funktion liege dagegen in der weltanschaulichen Selbstbestätigung von Lebensformen, wobei sich im „rhetorischen Kampf“ allmählich abzeichne, daß sich die Hausfrauenehe auf dem Rückzug und das Doppelverdienerpaar auf dem Vormarsch befinde. Dieses Modell läßt für Frauen nur die Wahl zwischen Entlastung durch Verzicht auf Kinder oder „Superwoman“, die sowohl Kinder als auch Karriere schafft. Immerhin sei es denkbar, daß sich die so überlasteten Frauen wehren – in diesem Sinne äußert Hondrich großes Verständnis für Eva Hermann.
Die von der Politik nun vorgegebene Leitlinie des doppelverdienenden und doppelterziehenden Paares („Superwoman“ und „Neuer Mann“) hält Hondrich im Hinblick auf die breite Bevölkerung für unrealistisch, weil es die Vorteile der Arbeitsteilung aufgebe. Statt der alten Arbeitsteilung zwischen verdienendem Mann und erziehender Frau sieht Hondrich daher eine neue Arbeitsteilung zwischen kinderlosen und kinderzeugenden Paaren, besonders solchen aus anderen Kulturkreisen, entstehen. Die von der Reproduktion entlasteten Frauen und Männer könnten dann noch mehr Zeit für „Bildung, Wissenschaft, Beruf, Weltpolitik und Weltmoral“ aufbringen und somit dafür sorgen, daß die Kinder der anderen „in europäischem Geist“ groß werden.
Die glorreiche Verwirklichung bzw. das tragische Scheitern dieser hochfliegenden Visionen wird Hondrich nicht mehr erleben können bzw. müssen. Er starb im Januar dieses Jahres im Alter von 69 Jahren an einem Krebsleiden.
geschrieben am 08.05.2007 | 1403 Wörter | 9962 Zeichen
Rezension von
Lesefreund
In manchen Bereichen der öffentlichen Diskussion zeichnet sich seit einiger Zeit ein regelrechtes Schreckensbild ab: Deutschland vergreist, die Spielplätze veröden, die Bevölkerung und mit ihr die Städte schrumpfen – oder werden sogar aufgegeben. Auf immer mehr Alte kommen in Zukunft immer weniger Junge, die eine immer größere Gesamtlast tragen müssen, seien es nun die Kosten für eine sich stetig verteuernde medizinische Versorgung oder etwa die vermehrten Aufwendungen für sozial Schwache oder andere Hilfsbedürftige. Überall im Land bieten sich dem Auge des Betrachters Szenarien dar, die die Frage aufkommen lassen, wie die Dinge sich überhaupt derart weit zuspitzen konnten.
weitere Rezensionen von Lesefreund

Karl Otto Hondrich, der vor kurzem verstarb, zeichnet in seiner Untersuchung ein alternatives Bild von der gegenwärtigen und – möglichen – künftigen deutschen Gesellschaft. Wie es typisch für dieses Land zu sein scheint, herrscht nach seiner Einschätzung die Angst vor, genauer gesagt: die inzwischen international bekannte 'german angst'. Wer hilft mir, wenn der Staat sich aus der sozialen Verantwortung immer weiter zurückzieht? Wie wird die Gesellschaft in Zukunft existieren können, wenn der Rundumschutz Stück für Stück abgelegt werden muss? Kommt es dann nicht zu furchtbaren Konflikten? So oder so ähnlich denkt es in vielen Deutschen – und so ängstigt man sich.
Solche und ähnliche (bangen) Fragen sind typisch für die Furcht vor dem Ungewissen, dem Unklaren der Zukunft. Was bei dieser Denk- respektive Angstweise Hondrich zufolge mitschwingt, ist die Sehnsucht nach Geborgenheit und Stabilität, der hier in Europa und vor allem in Deutschland ein besonders hoher Stellenwert zukommt. Stabile Verhältnisse sind aber auch von Nachteil, etwa wenn es gilt, auf Veränderungen zu reagieren und neue Strukturen zu schaffen. Die deutsche Wirtschaft ist im Prozess des stetigen (ökonomischen) Wandels auf eine Nische ausgewichen, um bei den hiesigen, relativ teuren und stark regulierten Arbeitsverhältnissen Anpassungen an den (weltweiten) Markt verkraften zu können. Das deutsche Zauberwort heißt Produktivität. Nur in wenigen Ländern auf der Welt wird derart produktiv gearbeitet wie in Deutschland. Der Grund liegt auf der Hand: Während etwa in den USA das berühmt-berüchtigte 'hire and fire' vorherrscht, tut man sich in europäischen Breitengraden eher schwer mit einem Wechsel des Arbeitsplatzes, der ja auch in seinem Bedeutungsgehalt bereits wesentlich statischer erscheint als der anglo-amerikanische 'job', den man wohl zu jeder Gelegenheit und fast an jedem Ort (Platz) erledigen könnte.
Da die deutsche Wirtschaft nun vor allem durch Produktivitätssteigerungen im internationalen Vergleich mitzuhalten sucht, wird die Arbeit hierzulande qualitativ immer besser und in Sachen Ausbildung und Qualifikation immer anspruchsvoller. Dies hat den Effekt, dass immer weniger Menschen immer mehr leisten können und daher immer wieder Personal abgebaut werden kann und wird. Wie diese freiwerdenden Kräfte dann ihrerseits wieder in Lohn und Brot kommen, ist eine Frage, die Hondrich zu einem weiten Exkurs in Sachen deutscher Sozialstaat ausholen lässt. Dessen Quintessenz lautet in etwa: Wirtschaft ist ein Prozess, der sich immer wieder selbst über den Markt reguliert, eine demographische Entwicklung hingegen, die von staatlicher Seite aus angeregt wird oder werden soll, hat immer den Nachteil, dass sie nur schwer Rücksicht auf kurzfristige Entwicklungen nehmen kann. Beim Thema deutscher Nachwuchs beißen sich demnach staatliche Planung bzw. Wunschvorstellungen über Bevölkerungszahlen mit den Anforderungen der Wirtschaft, die ihre Arbeitskräfte nicht unbedingt über den in Deutschland heranwachsenden Nachwuchs rekrutiert .
So steht auf der einen Seite eine immer effizienter und in immer spezielleren Bereichen agierende deutsche Wirtschaft, die mit immer weniger hoch- und höchstqualifizierten Arbeitskräften auskommt, einem Staatsdenken gegenüber, das gleiches Recht für alle bei zum Teil hochgradig verschiedenen Ausgangsbedingungen der Individuen zu verwirklichen sucht. Der Geburtenrückgang ist in Hondrichs Augen eine vollkommen normale Reaktion auf die sinkende Nachfrage nach neuem Leben, zum einen dadurch, dass bereits geborene Individuen immer länger leben und zum anderen, dass Deutschland mit gut 80 Millionen Einwohnern eine Bevölkerungsdichte aufweist, die historisch ihresgleichen sucht.
Als Fazit lässt sich formulieren, dass die Zahl der Geburten – und damit die Zahl der Nachkommen – zwar tatsächlich zurückgeht, diese Entwicklung jedoch eher ein Segen als ein Fluch ist und im Übrigen bereits spätestens mit Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Den Menschen in Deutschland geht es heute besser denn je. Dies ist nach Ansicht Hondrichs nicht die Folge zahlreicher(er) Geburten, sondern das Ergebnis von wirtschaftlicher Prosperität. Diese kann sich nur in Freiheit entfalten und dadurch für Dynamik und Wachstum sorgen, während ein staatlich geförderter Geburtenanstieg kurzfristig zwar zu mehr Nachwuchs führen kann, diese neuen Menschen jedoch nicht von selbst gut dastehen, sondern die Wirtschaft brauchen, um sich ein gutes Leben leisten zu können.
geschrieben am 23.10.2007 | 733 Wörter | 4519 Zeichen









Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen