Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
UTB: Europäische Kulturgeschichte – Eine Einführung
| ISBN | 3825283461 | |
| Buchreihe | UTB | |
| Autor | Silvio Vietta | |
| Verlag | Fink | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 536 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | broschierte Ausgabe |
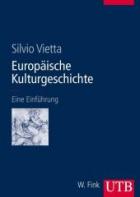
Rezension von
Hiram Kümper
Mit seiner „EinfĂĽhrung“ legt Silvio Vietta, Ordinarius am Institut fĂĽr deutsche Sprache und Literatur der Universität Hildesheim und jĂĽngst nun auch Nietzsche-Preisträger des Landes Sachsen-Anhalt, einen gelehrten und ausgesprochen geÂdankenÂreichen Zugriff auf die gesamte europäische Kulturgeschichte von der frĂĽhen Antike bis in die gegenwärtigste Moderne vor – die „so geÂnannte“ Postmoderne als spezifische Epoche weist der Vf. von sich („Selbst wenn Postmoderne als Krise der Moderne begriffen wird, signalisiert dies keine neue Epoche.“, S. 17). Kultur wird dabei verstanden als „sprachlich ermöglichte und vermittelte Form von WeltÂerfahrung und WelterschlieĂźung, in deren Kontext sich das konkrete Denken, Sprechen und Handeln von Menschen vollzieht. Dieses Denken, Sprechen und Handeln“, so Vietta weiter, „bildet selbst kulturelle Subsysteme, die ihrerseits das Gesamtsystem einer Kultur definieren“ (S. 32).
weitere Rezensionen von Hiram KĂĽmper

Gleich zwei weite Zugriffe also: ein weiter Kulturbegriff und ein weiter Zeitrahmen (und der Vf. warnt uns auf S. 31 sogar noch vor einem zu engen Sprachbegriff!). Dass beides auf den etwas ĂĽber 500 Seiten dieses Bandes kaum aus jeglicher Perspektive zur nötigen Tiefe gelangen kann und jeder Leser etwas wird finden können, was von der jeweils eigenen Warte aus fehlt, zu oberflächlich behandelt oder in fragliche DeutungszusammenÂhänge eingeordnet wird, liegt auf der Hand.
Vietta nimmt sich vor, europäische Kulturgeschichte anhand dreier Achsen („LeitkodieÂrungen“) zu lesen, die richtungsweisend fĂĽr die europäische Kulturentwicklung waren: griechischer Logos, christliche Pistis und neuzeitlicher Rationalismus. Das ist nicht neu, aber als Ansatz erst einmal einleuchtend. Dieser strukturelle Ansatz flieĂźt dann leider weiter in eine im Grunde rĂĽckschrittliche Kulturstufentheorie in neuem Gewand, wenn man so will: eine moderne Form der aetates mundi (hier nun: europaeum) als Stufen der europäischen Kulturentwicklung – freilich im neuen Gewand systemtheoretischen Vokabulars. Sinnhaft aufgeladen durch den leitenden Code des Mythos sei demnach eine urgeschichtliche Epoche gewesen, die Vietta ungefähr im 6. vorchristlichen Jahrhundert enden lässt, wenn mit der griechischen Antike der Logos die Rolle der Leitkodierung ĂĽbernimmt. Dieser wird wiederum etwa um das 3. Jahrhundert v. Chr. abgelöst durch die Leitkodierung imperialer Macht der römischen Antike. Ihr folgt gegen Ende des 5. Jahrhunderts – ganz gemäß traditioneller Epochengrenzen – die Offenbarung als leitende Kodierung des christlichen Mittelalters, die um 1500, so Vietta, vom wissenÂschaftÂlich-rationalen Logos abgelöst wird.
Im Folgenden konzentriert sich die Darstellung dann auf die drei oben genannten Achsen bzw. Leitcodes und die ihnen korrespondierenden Kulturepochen. Die zeitliche LĂĽcke, die das Fehlen der römischen Antike (Leitkodierung: „imperiale Macht“) in diese Darstellung reiĂźt, bleibt auch inhaltlich haften und will, gerade angesichts der jĂĽngsten Konjunkturen des Imperialismus-Begriffs, nicht so recht einleuchten. Auch sonst stellt sich der Band eher als ein Patchwork denn als systematische Geschichtsschreibung dar, denn eingehende Analysen wechseln sich ab mit ziemlichen Allgemeinplätzen, die bestenfalls als Kitt zwischen vor allem literaturwissenÂschaftlichen und philosophiehistorischen EinzellektĂĽren fungieren. Hier freilich zeigt sich Vietta dann als profunder Kenner und als wacher Denker, der innovativ ĂĽber das Altbekannte hinauszugehen vermag. Es bleibt aber nur Ausschnitt, der die konstitutive VerÂwobenheit von Kultur mit sozialer Praxis weitgehend ausblendet. So entsteht eine zwar vernetzte, aber letztlich doch immer noch in weiten Teilen eine bloĂźe Ideengeschichte, die sich beinahe zwangsÂläufig auf den eher ausgetretenen Höhenkämmen der Geistesgeschichte abspielt und mit einem kulturhistorischen Kolorit angereicht wird, der bei genauerer Betrachtung oftmals doch etwas dĂĽnn bleibt. SchlieĂźlich bleiben einige Literaturreferate missverständlich fĂĽr den unkundigen Leser, was gerade bei einer EinfĂĽhrung misslich ist. Gegen eine SexualitätsÂgeschichte als reine „Repressionsgeschichte“ beispielsweise hat Foucault, auf den sich Vietta S. 222 bezieht, ja geÂrade anzuschreiben gesucht.
Genug Kritik also. Das ist kein Wunder. Viettas Buch ist – ich greife die anfänglichen Ăśberlegungen auf und sage: natĂĽrlich – keine runde Darstellung der europäischen Kulturgeschichte und enttäuscht daher Erwartungen, die der Titel weckt. Es kommt auch und gerade als EinÂfĂĽhrung, als die sich dieser Band ja explizit verstanden wissen will, nicht ohne Probleme daher, denn trotz hoher Erzählkunst verlangt Vietta viel vom Leser – vor allem viel zusätzliche LektĂĽre. Dem wird auch durch das beigefĂĽgte Glossar nur bedingt abgeholfen; auch ein Sachregister wäre fĂĽr diesen ebenso inhaltsreichen wie manchmal sprunghaften Band wichtig gewesen.
Im Grunde ist dieses Buch aber viel weniger ein historisches als ein philosophisches Werk und zeigt gerade damit auch seine besonders starke Seite. Denn Viettas Entwurf einer interdisziplinären „EuroÂpäistik“, vor allem sein Hinweis auf die Stratifikation metaphysischen Denkens als roter Faden europäischer Kulturentwicklung (S. 15ff.), ist nicht nur ein zweifellos gelehrter, sondern vor allem ein sehr nachdenkenswerter. Kein empfehlenswertes Lehrwerk also. Aber eine anregende LektĂĽre.
geschrieben am 07.04.2008 | 724 Wörter | 4763 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen