Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Metaphysik der Entropie.
| ISBN | 3980553450 | |
| Autor | Winfried H. Müller-Seyfahrt | |
| Verlag | VanBremen | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 210 | |
| Erscheinungsjahr | 2000 | |
| Extras | - |
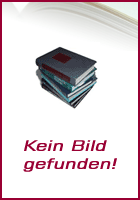
Rezension von
Daniel Bigalke
Winfried Müller-Seyfarth, der Herausgeber der bibliophilen vierbändigen Schriften Philipp Mainländers, hat unter dem hier vorliegenden Titel "Metaphysik der Entropie" eine eigene Studie zur transzendentalen Analyse und ihrer ethisch-metaphysischen Relevanz des Radikalpessimisten Mainländer vorgelegt. Wie nicht anders zu erwarten, erweist sich der Berliner Thanatologe als überzeugender Kenner der Gedankenwelt Mainländers. Das Buch ist versehen mit einem Vorwort von Franco Volpi, der den Autor völlig zu Recht als Spezialisten auf seinem Facht sieht.
weitere Rezensionen von Daniel Bigalke

Die Grundlage des mainländerschen Denkens besteht darin, daß, wenn die herkömmliche Transzendenz ihre Verbindlichkeit verliert, man vor der Unendlichkeit des Alls erschaudert, der Mensch zwangsläufig auf sich selbst gestellt seine eigene Freiheit verlangt und die Frage der metaphysischen Heimatlosigkeit, des Mangels an einem transzendentalen Rückzugsort auf seine eigen Weise beantwortet – ohne herkömmliche religiöse Schemata. Genau dies tat Mainländer konsequent und überzeugend. Müller-Seyfarths Studie setzt mit einer Untersuchung der "Kant-Modifikationen" Mainländers ein. Ebenso zeigt er Mainländers Missverständnisse der Transzendentalphilosophie auf und verhehlt auch nicht, wo seine „Verbesserungen“ hinter Kant zurückbleiben.
Ein besonderes Augenmerk richtet Müller-Seyfarth auf Mainländers Verhältnis zu Julius Bahnsen. Beide stünden auf den Schultern Schopenhauers. Anders als Schopenhauer, der von nur einem Willen sprach, der im principium individuationis als vielfältig erscheine, entwickelten seine beiden originellsten Schüler jeweils einen „Willenspluralismus“. Im Buch wird sehr detailliert und spannend die Gedankenwelt Mainländers analysiert. Das Prinzip von der Thanatologie Gottes steht dabei im Mittelpunkt:
Gott war gestorben und sein Tod erst war das Leben der Welt!
Mainländers Philosophie ist von Anfang an auf Erlösung angelegt. Sein vorweltliches göttliches Subjekt, das All-Eine, kann sich von seinem Leiden und Dasein nur über einen Umweg erlösen. Zuvor muß es sich in einem Akt der Transformation und Materialisation zur Welt zersplittern, damit die in ihr sich bekämpfenden Individualwillen irgendwann im Zustand der Erschöpfung endlich ihre Auf- und Erlösung finden kann - und mit ihnen und der gesamten Welt auch der ursprüngliche Gott.
Kurz: Als Sachverhalt gilt Mainländer der Zerfall der vorweltlichen einfachen Einheit in die immanente Welt der Vielheit, der Tod Gottes und die damit erst ermöglichte Geburt der Welt. Die Welt ist das Mittel zum Zwecke des Nichtseins – über den Weg der unüberwindbaren kontinuierlichen Schwächung der Kräfte, die das Seiende ausmachen. Selbst der Zweck des lebensbejahenden und lebensverneinenden Menschen ist beiderseits der Tod, denn beide erreichen den Tod unweigerlich. Der eine im Willen zum Leben und der andere im Wissen davon, daß es kein Ausweichen vor dem Nichts gibt. Der lebensverneinende Mensch jedoch schwächt effektiver die Kraftsumme des Alls als der krampfhaft am Leben hängende.
Ruhe bedeutet für Mainländer Tod, der Schlaf ist Waffenstillstand im Kampf ums Dasein und die Rückkehr in die vorweltliche Kampflosigkeit als Überwindung des Weltzwiespaltes. Ein permanenter Energie- und Seinsverschleiß prägt das Sein, an dessen Ende das Nichts steht. So versteht sich von selbst, warum Mainländer jedem Lebewesen ein Streben nach dem Nichts, der Ruhe des Todes unterstellt, gleichgültig, ob dies anerkannt wird oder nicht. – Es ist einfach so. Mehr noch: Das Gesetz des Schmerzes radikalisiert den Pessimismus Schopenhauers mit der Konsequenz von Freitod und Virginität, um dem absoluten Nichts aktiv ins Auge zu blicken und die einzig effektive Konsequenz zu ziehen. Der Suizid stellt aufgrund der universellen Schwächung der Kraft, die jeden betrifft, damit keinen Unterschied zum Willen zum Leben dar. Tod wird nicht als Übel gesehen, sondern als Erlösung im Sinne des lediglichen Einfügens in die Schwächung der Kraft im All.
Jedenfalls haben sich seit Schopenhauer, Bahnsen und Mainländer, wie der Autor formuliert, "die Gründe für den philosophischen Pessimismus verstärkt". Das Buch ist ein Geheimtipp für Liebhaber des Pessimismus, die nicht unbedingt abseits vom Leben stehen müssen, denn Mainländer selbst war Soldat, Bankangestellter und versierter Spekulant im Geldgeschäft. Er zeigt, daß philosophischer Pessimismus nichts für Weltabgewandte ist, auch wenn sie – im Philosophischen – genau diese Konsequenz ziehen.
Die vorliegende monographische Gesamtdarstellung ist optimal zur Einführung, aber auch durch ihre stellenweise Tiefe sehr geeignet zum fortgeschrittenen Studium, so etwa mit Blick auf die enthaltene Geschichte der Mainländer-Rezeption durch Nietzsche oder E.M. Cioran.
geschrieben am 31.01.2009 | 655 Wörter | 4177 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen