Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
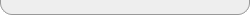
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Yunnan
| ISBN | 390258520X | |
| Autor | Carina Nekolny | |
| Verlag | Kitab | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 221 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |

Rezension von
Thierry Elsen
Eine Reise unter sĂĽdlichem Himmel ins innerste Ich
weitere Rezensionen von Thierry Elsen

China ist für die meisten Europäer/innen eine Schlagzeile im lokalen Wirtschaftsteil einer Zeitung oder das Büffet beim Chinesen um die Ecke, bei dem man/frau sich für weniger als 10 Euro den Bauch voll schaufeln kann. Keinen Unterschied macht es für die meisten, ob die Speisen aus Kanton oder einer der anderen Regionen stammen. Vielleicht aus Yunnan? Wo bitte ist Yunnan?
Carina Nekolny hält uns in ihrem Roman „Yunnan – Unter südlichem Himmel“ ein Porträt jener Region vor Augen, die sich im Süden Chinas an die Nachbarstaaten Laos, Vietnam und Myamar schmiegt. Ausgangspunkt der Reise, die vornehmlich mit dem Bus über Stock und Stein führt, eine Brücke, die von Vietnam nach China führt. Die namenlose Protagonistin und ihr Begleiter, der stets nur mit dem Anfangsbuchstaben H. bezeichnet wird, gehen zum Bahnhof. Der erste Eindruck ist jener der Fremde und des Ausgestoßenseins. Dieser Eindruck wird sich im Laufe der Reise noch verstärken. Die Protagonistin und ihr Begleiter sehen sich in einer Welt der fremden Zeichen, der fremden Umgangsformen, der Chiffren und der Codes. „Du lebst als Analphabetin in ihrer Zeichenwelt. Wie ein Kind in der Welt der Großen, derer, die das Geheimnis der Schrift kennen, der Eingeweihten. Du bist nicht eingeweiht. Der Sinn der Zeichen bleibt dir verborgen. Geheim. Du weißt nichts. Kannst nicht wissen. Du gehörst nicht dazu. Sie schwimmen an dir vorbei, ohne Kontakt. Sie streifen dich mit Blicken, hüllen dich in ihre Gerüche und Bräuche, ohne dich zu berühren.“ (Seite 125). Die beiden Reisenden tauchen ein in eine Masse aus Menschen. Eine lethargische Masse von Körpern, die auf unsichtbare Impulse zu reagieren scheint. Und trotzdem: Sie sind die „Langnasen“, die immer und überall auffallen, die trotz aller Gastfreundschaft, die sich auftut, immer nur die Außenstehenden sind. Das Land ist unlesbar und trotzdem entsteht der Eindruck, dass ein Teil dieses Chinas so sehr in Richtung westlicher Kultur strebt, dass es schon grotesk wirkt. Dies führt zu absurden Begebenheiten wie etwa den „German Weeks“ in einem der besten Hotels am Platze. „Der Gestank von Maggi und schlechtem Öl lag in der Luft. Stellten sich so die Leute hier deutsche Mentalität, deutsches Essen vor? Die beiden sahen sich an. So wie unsere Bilder vom Fremden, von anderen, ging es der Frau durch den Kopf? So verzerrt und absurd. So wie wir hier herumtreiben und schauen und uns Bilder zurechtlegen von dem, wie es hier ist. Schau wie sie essen, wie sie das ungewohnte europäische Werkzeug, Messer und Gabel halten, den Tee, das Bier schlürfen. Zurechtgelegte Bilder.“ (Seite, 17). Doppelt absurd, weil der Befund ja auch für die eigene Befindlichkeit herhalten kann und muss. Und so wie die Chines/innen sich „German Weeks“ vorstellen, so ist Österreich auch überall bekannt – Audili, der Name ist Programm voller Musik. Klischees hier, Klischees dort. Eine Flut von Bilder stürzt auf die Protagonistin ein, die den unbändigen Drang verspürt, die neue Welt mit Hilfe von „so wie“ Analogien zu benennen und zu begreifen.
Auf der weiteren Reise wird der/die Leser/in mit den Schönheiten und Begebenheiten der Region bekannt gemacht. Die Begegnungen mit Einheimischen finden nur aus Neugierde seitens der Einheimischen statt. Die Bilder sind seltsam genug. Es ist wenig Platz für verkitschte Pagodenromantik. Hier sind die Langnasen die Fremden, die im Bus wie selbstverständlich die schlechtesten Plätze bekommen. Die überlebensgroße Maostatue hier, die Reisterrassen und Tempel dort. Aber auch die aus allen Nähten platzenden Ortschaften mit ihrer schlechten Luft, dem mühsamen Atmen und dem unmöglichen Verkehr, bis hin zu arkaischen Ritualen, wie dem Opfern einer Schlange, oder dem Schlangenschnaps. Bei der Beschreibung der Atmosphäre benutzt die Erzählerin sehr oft das charakterisierende Beiwort „ölig“ - ölig im Gegensatz zu „luftig“ und „klar umrissen“. Ölig vielleicht auch im Sinne von „klebrig“...
Am Anfang ist die Protagonistin noch bereit das Land zu entdecken und sich anzueignen. Doch zunehmend nimmt die Reise Besitz von ihr. Entfremdung macht sich breit in der Fremde. Die Harmonie zwischen ihr und ihrem Freund schwindet. H. hat keine größeren Probleme, mit den Einheimischen Bier zu trinken. Er ist sich seiner Position bewusst. Er ist der Zielstrebige, der Jäger, der die verschiedensten Dinge aufzuspüren vermag: seien es die Gummilatschen, die alle Einheimischen tragen, oder die nächste Garküche mit einer regionalen Spezialität. Seine Nasenflügel haben die besondere Eigenschaft, im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt zu werden. Der langsame Prozess wird von einem kleinen Streit eingeleitet. Er (H.) will in die Drachenschlucht, seiner Abenteuerlust frönen, ihr ist dies zu gefährlich. Die Dissonanzen steigern sich im Rhythmus der Reise. In Momenten der größten Nähe rücken sie voneinander ab. Die Hölle ist DER andere. Sie, die Feministin, hasst ihn, den Mann, der sich männlich gebärdet. Zu männlich. Die Gedanken über H. weichen zunehmend zu Gunsten von Erinnerungen an das Kind, das zu Hause blieb. Traum und Wirklichkeit verschwimmen immer mehr für die Protagonistin und münden in einer intimen, nächtlichen Begegnung. Der Höhepunkt der inneren Verwandlung ist erreicht. H. indes scheint für den/die Leser/in derselbe zu bleiben, der Joviale, der Neugierige, der seinen Instinkten vertrauen kann und den Dingen ihren Lauf lässt. Er lässt sich treiben und ist unbeteiligt. Endstation ist Hongkong – das westliche Hongkong, das jedoch keinen Trost zu spenden mag.
Carina Nekolnys Stil ist anspruchsvoll. Freund/innen eines ruhigen deskriptiven Erzähltons werden mit diesem Buch herausgefordert. Besonders die Traumsequenzen werden von einem zerrissenen, atemlosen Stil, der das Verb oft ausspart, getragen. Die Autorin kleidet die zahlreichen Gedankenblitze und -ketten in ein passendes sprachliches Kleid. Auf der anderen Seite stehen die bereits erwähnten „So wie“-Beschreibungen, mit der nicht nur die Protagonistin ihre Umwelt in den Griff bekommen will, sondern auch dem/der Leser/in nahe gebracht werden. Die Figurenhzeichnung bleibt – wie es im Kritiker/innenjargon heißt – holzschnittartig, vielleicht auch bewusst „ölig“.
Yunnan – unter südlichem Himmel ist Reise- und Entwicklungsroman zugleich. Eine Reise zwischen den Welten und zwischen Traum und Wirklichkeit. Eine Reise ins äußere China und die innere Welt einer Protagonistin, die alle Sicherheit verliert.
geschrieben am 19.07.2009 | 981 Wörter | 5649 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen