Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Reflections in a Serpentâs Eye
| ISBN | 019955692X | |
| Autor | Micaela Janan | |
| Verlag | Oxford University Press | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 276 | |
| Erscheinungsjahr | 2009 | |
| Extras | - |
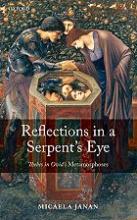
Rezension von
Anna Kneisel
Micaela Janan bespricht Ovids auĂergewöhnliche Geschichte der GrĂŒndung Thebens in âReflections in a Serpentâs Eyeâ vor dem Hintergrund der aktuellen Tendenz in der Klassischen Philologie, antike Mythen nach psychoanalytischen Gesichtspunkten zu interpretieren, insbesondere in der Nachfolge von Freud. Meist konzentrierten sich psychoanalytische Theoretiker bei der Untersuchung von Mythen, die auf ihre psychologischen Hauptmerkmale reduziert wurden, auf weniger komplexe Darstellungen jener Mythen und nicht so sehr auf die ErzĂ€hlversionen Ovids, der bewusst spielerisch und dabei dennoch als poeta doctus erkennbar und sehr kunstfertig mit den Stoffen umging. Die Autorin belĂ€sst es bei ihren AusfĂŒhrungen zu Ovids Theben und den verschiedenen Charakteren jedoch nicht bei einer einseitigen Darstellung, sondern vergleicht seine Herangehensweise mit derjenigen moderner Autoren, beispielsweise T.S. Eliot oder Hardie. Sie stellt nicht umsonst Narziss auf eine herausragende Position in ihrer Monographie, einerseits Narziss als Ădipus, andererseits auch die Beziehung zwischen Narziss und Echo. Die Autorin nennt entsprechende Textstellen aus den Metamorphosen, Tristien und anderen Werken Ovids, und die umfangreichen FuĂnoten geben ĂŒber die ĂŒblichen Quellenangaben hinaus umfangreiche Zusatzinformationen.
weitere Rezensionen von Anna Kneisel

Das Individuum und das Selbst, Sprache und IntersubjektivitĂ€t stehen im Mittelpunkt, sowie die Bedeutung von Anarchie und Ordnung in der menschlichen Gesellschaft. Janan versucht auf diesem Weg, eine BrĂŒcke von der Antike mit ihren Mythen zur Moderne und der modernen Rezeption zu schlagen.
Ein umfangreiches Einleitungskapitel zur Vorgehensweise mit Bezugnahme auf eine Vielzahl bedeutender Namen wie Gian Biagio Conte, Alessandro Barchiesi und auch Stephen Hinds gibt die Richtung des Bandes vor: IntertextualitÀt wird hier groà geschrieben, denn ein poetischer Text erhÀlt seine Bedeutung in der Relation zu den unzÀhligen anderen Ausdrucksweisen der literarischen Tradition, so Janan. Kontext sei dabei theoretisch grenzenlos und weder durch das zu umschreiben, was der Autor meinte, noch durch das, was das zeitgenössische Publikum verstanden hÀtte.
In Kapitel 2 âIn Nomine Patris: Ovidâs Theban Lawâ, wird auf Agenor und die âsavagery of lawâ eingegangen: Er will seinen Sohn Cadmus ins Exil schicken, falls dieser Europa nicht findet, die von Jupiter entfĂŒhrt wurde. Bei Ovid liest sich dieser Beschluss sowohl als Ausdruck von pietas als auch scelus, sodass Janan zufolge Agenor zur sadistischen und vernunftlosen Kehrseite des Gesetzes wird. Der Bogen wird in diesem Kapitel auch zu den politischen UmstĂ€nden der augusteischen Zeit, also der Zeit Ovids geschlagen.
Kapitel 3 trĂ€gt den Titel ââThâ Unconquerable Will, and Study of Revengeâ: Juno in Thebesâ. Es analysiert den Charakter Junos und macht deutlich, dass es Eifersucht ist, die sie gegen Jupiters (oft unfreiwillige) Gespielinnen vorgehen lĂ€sst. Der Höhepunkt ihres Rachefeldzuges wird offensichtlich in Theben erreicht. Janan bemerkt weiter, dass Juno am meisten dann sie selbst ist, wenn sie andere auslöscht. Sie beschreibt jedoch ihr Verhalten vor dem Hintergrund der Theorien von Freud, Lacan und Zizek.
Die Kapitel 4 (âNarcissus and Echo: The Arrows of Loveâs Errorsâ) und 5 ( âThrough a Glass, Darklyâ: Narcissus as Oedipus) haben weiter die Mann-Frau-Beziehung und die Wahrnehmung der âslippery of identityâ im Fokus. Micaela Janan sieht die Charaktere als Beispiele fĂŒr wesentliche Merkmale zwischenmenschlicher Beziehungen mitsamt ihrem Scheitern.
Kapitel 6 âPentheus Monsters Thebesâ befasst sich mit Theben als ideale Stadt auf der einen Seite mit dem Individuum als selbstĂ€ndigem Bestandteil, auf der anderen Seite aber auch als das genaue Gegenteil. Ovid beschreibt eine Welt, die immer im Fortschritt begriffen ist und in der die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Gewalt zu einem bloĂen Konstrukt wird. Janan verbindet dabei die Schlange in Theben mit der römischen Wölfin und versteht die Pentheus-Geschichte auch als Kommentar zum augusteischen Herrschaftsdenken mit dem ostentativen aber gleichzeitig nicht völlig echten Hochhalten von Gesetz und Ordnung.
Chronologisch geht es in Kapitel 7 nun weiter zu der Zeit nach Augustus: âOvid and the Epic Tradition: The Post-Augustansâ. Sowohl Ovid als auch Vergil werden zu hĂ€ufig zitierten Vorbildern, wobei Janan jedoch Autoren wie Lukan, Statius und Valerius Flaccus als Nachfolger beider sieht.
Anders als zu erwarten liegt der Schwerpunkt von Janans AusfĂŒhrungen jedoch nicht auf Ovids Werken sonder vielmehr bei der modernen Rezeption der Mythen und man kann sich nicht ganz des Eindrucks erwehren, dass die Autorin Ovids Werke den psychoanalytisch geprĂ€gten Theorien anpasst und nicht andersherum â was nicht passt, wird passend gemacht. Dies hat zur Folge, dass ihr Werk ein wenig an Ăberzeugungskraft einbĂŒĂt â ein unnötiger Verlust, da Ovid doch so verstĂ€ndig wie kaum ein anderer die menschliche Psyche durchschaute und spielerisch mit den wirkenden TriebkrĂ€ften im menschlichen Miteinander umging. Dennoch: Die umfassende VerknĂŒpfung mit den unterschiedlichsten Werken ist beeindruckend und zeigt eine tiefgehende BeschĂ€ftigung mit der Thematik, durch die moderne und antike Literatur im Kontext gesehen werden. â Nicht nur fĂŒr Altphilologen geeignet.
geschrieben am 30.04.2011 | 752 Wörter | 4661 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen