Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
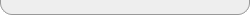
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Ein neues Deutschland? Zur Physiognomie der Berliner Republik. Sonderheft MERKUR (Nr. 689/690)
| ISBN | 3608970843 | |
| Verlag | Klett-Cotta | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 261 | |
| Erscheinungsjahr | 2006 | |
| Extras | - |

Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Ist mit der Bundesrepublik Deutschland Staat zu machen? Muss ein Staat ästhetisch sein? Sollte ein soziales Gemeinwesen, nicht nur geschaffen zum Ausgleich und der Bündelung menschlicher Interessen, in irgendwelcher Hinsicht den Grundsätzen des Schönen entsprechen? Oder zumindest auf diese Rücksicht nehmen? Muss die Kanzlerin eine Vorbildfunktion erfüllen? Spielt es eine Rolle, wie sie sich artikuliert, wie sie gekleidet ist, wie sie sich bewegt?
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

In früheren Jahrhunderten herrschte die Aristokratie nicht nur politisch über das Volk. Auch in allen Belangen des Ästhetischen hatte der königliche Hof eine nicht in Frage zu stellende Vorbildfunktion. Hier waren die Menschen schön angezogen, hier wurde musiziert und standen die Bibliotheken. Wie die Kreise nach einem Steinwurf ins Wasser, so zog sich dieser Einfluss und Anspruch immer weiter vom Hof weg nach außen. Umso mehr man mit dieser Schicht zu tun hatte, desto stärker versuchte man, ihren Gepflogenheiten zu genügen. Diesen Anspruch hatte man an sich selbst. Der Titel des Königlichen Hoflieferanten wurde so zu einem Qualitätssigel. Später versuchte das aufkommende Bürgertum zunächst, aristokratisch zu wirken. Noch im zwanzigsten Jahrhundert stand in den Häusern des Bürgertums ein Klavier, und man besaß eine Bibliothek, die diesen Namen verdiente.
Heute scheint dies alles ein wenig anders zu sein. Das hat viel damit zu tun, wen wir für uns als Vorbild ansehen, akzeptieren. Auf einer Aids-Benefizgala gibt Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit der RTL-Dschungelshowgewinnerin Désirée Nick einen intensiven Zungenkuss. Beide sitzen inmitten von Kamerateams, Fotografen und Ballgästen. Der Regierende Bürgermeister hatte die Veranstaltung mit seinem Lebensgefährten besucht. Sein Gesichtsausdruck verrät den angeheiterten Zustand. Am nächsten Tag fragt die Bild-Zeitung mit großer Schlagzeile scheinheilig: „Wowereit nicht mehr schwul?“ Einigen Insidern war aufgefallen, dass Bild zwei Jahre zuvor eine inhaltlich identische Geschichte gebracht hatte. Da hatte das Blatt gefragt: „Kann Sabine Christiansen Wowereit umdrehen?“
Die Prominenz der Berliner Republik wird in ihrer Kapitale durch drei Figuren repräsentiert: Sabine Christiansen, Klaus Wowereit, Udo Walz. Erstgenannte ist sogenannte Fernsehmoderatorin und mit den anderen beiden befreundet. Die anderen beiden sind mit ihr wohl auch befreundet. Walz wird in der Medienrepublik als Star-Coiffeur betitelt, will sagen: Er ist der Friseur von Christiansen, Gerhard Schröder, Guido Westerwelle und vielen anderen Prominenten und Wenigerprominenten, die am Auto einen Sylt-Aufkleber haben. Politisch macht er von sich reden, indem er bei Wahlkämpfen gleich für mehrere Parteien gleichzeitig Wahlempfehlungen ausspricht. In seinen Salons ist die Stimmung wie in den Medien und der Politik. Oberflächlich-nett ist man zu den Kunden. Die Mitarbeiter werden nur angeraunzt. Das stört die Kunden nicht, man will dabei sein. Deshalb hat Walz jetzt auch Salons auf Sylt und Mallorca.
Der „Tagesspiegel“ sorgte sich um die Promi-Karriere des Friseurs: „Nur als Tröster der prominentesten betrogenen Ehefrau Berlins taucht er seit Wochen in den Klatschspalten auf - ein Foto zeigte ihn jüngst neben Sabine Christiansen im gemeinsamen Karibik-Urlaub. Dabei galt bisher eine Fete ohne Udo Walz nicht als Fete. Seinen Titel als Partymeister droht der Friseur nun an den Regierenden Bürgermeister zu verlieren. Und nicht nur das: Wenn Wowereit so weitermacht, spielt Walz auch als bester Freund Sabine Christiansens im Zeitungsklatsch bald die zweite Geige. Beim Presseball ließ sie sich im Arm Wowereits ablichten - wohl frisiert von ihrem Udo. Der macht sich derweil keine Gedanken. Vielmehr freut es ihn, dass sich seine Sabine nicht nur wieder toll fühlt, sondern auch toll aussieht - und neben ‚Wowi’ einen großen Auftritt hatte. ‚Ich bin kein Ballgänger, gehe lieber in Kneipen, die Paris-Bar ist bekanntlich mein Wohnzimmer’. Auch beim Zarenball war er nur dienstlich. Dabei hatte man ihm die Mitgliedschaft in einem ‚Kuratorium’ angedichtet. ‚Was soll das?! Ich habe abends dreißig Barockfrisuren gemacht.’ Dies immerhin als Ballspende - so wie er den im Sommer für 25 000 Mark ersteigerten Fummel von Veronika Feldbusch für eine gute Sache spenden will. Leisten kann sich der Schwabe das locker - ein wenig ist das auch seiner Kundin Sabine Christiansen zu verdanken. Sie macht mit neuen Klamotten und mit neuer Frisur beste Reklame für ihn: Mindestens acht bis zehnmal täglich wollen Berlinbesucherinnen im Salon von Udo Walz ‚die Haare wie Sabine Christiansen’, erzählt er vom haarigen Boom - ohne Garantie für treue Männer.“ Auch die verniedlichende Koseform des Namens spricht Bände über den Zustand unseres Gemeinwesens. Seine mangelnde Souveränität offenbarte „Wowi“ im November 2006, als ihn der völlig versagende Parlamentspräsident Walter Momper trotz fehlender Mehrheit fragte, ob er die Wahl zum Regierenden Bürgermeister annehme. Wowereit antwortete vorschnell mit ja. Bei der Vereidigung nach dem zweiten Wahlgang riss er dem unwürdig stammelnden Momper den Zettel mit der Vereidigungsformel aus der Hand und las den gesamten Text, den der Parlamentspräsident zu sprechen hat, dann selbst mit brüchiger Stimme ab.
Es scheint also angebracht, sich anderthalb Jahrzehnte nach der Vereinigung mit der Ästhetik der Berliner Republik zu befassen, wie es die Doppelnummer des Merkur tut. In seinem fulminanten Eröffnungsbeitrag sieht Herausgeber Karl Heinz Bohrer hoffnungsfrohe Anzeichen für eine Wandlung am Horizont. Es sei ein Umbruch „hinsichtlich ästhetischer Kapazität“ spürbar. „Ausdruckslosigkeit als Stilphänomen ist immer ein Mangel an Bewußtsein von sich selbst und von vergangenen eigenen Normen, zu denen man sich in Beziehung setzt: Mangel also an Selbstbewußtsein, der für mehrere deutsche Nachkriegsgenerationen charakteristisch war. Das aber scheint im Begriff zu sein, sich nachdrücklich zu ändern.“ Bohrer spricht über die Bedeutung des Ästhetischen: „Das Äußerliche, die Form, wird fälschlicherweise als bloße Zutat gesehen, wo es sich doch um etwas Essentielles handelt. Das hat die Geschichte der Zivilisation gelehrt.“ Schon Nietzsche beantwortete die Frage „Was ist vornehm?“ unter anderem damit, dazu gehörten die Lust an der Form, die Höflichkeit. Mangel an Höflichkeit ist Mangel an Kultur. Es ist Bestandteil der Ästhetik eines Staates, dass die Bevölkerung sich in ihrem Verhalten an dem ausrichtet, was ihr fernsehtäglich vorexerziert wird. Daher ist es nicht gleichgültig, wenn sich der Bürgermeister der deutschen Hauptstadt vor den Kameras wie ein Flittchen benimmt.
Verschiedene Beiträge klopfen unseren neuen deutschen Staat nach seiner Ästhetik ab. Insgesamt kann das Doppelheft mit seinen über 250 Seiten – wie schon die vorhergehenden Doppelnummern des Merkur – als Seismograph unseres Status gesehen werden. Um mit einem Buchtitel aus den 1960er Jahren zu sprechen: „Wo stehen wir heute?“ Publizisten, Wissenschaftler und Schriftsteller befassen sich intelligent mit den verschiedensten Facetten. Besonders hervorzuheben ist neben Bohrers „Die Ästhetik des Staates revisted“ der Beitrag vom „Dandy der Medientheorie“ (Der Spiegel) Norbert Bolz: Postjournalismus. Der Berliner Professor für Medienwissenschaft beschreibt essentielle Veränderungen in der Medienlandschaft, ohne zu einfachen Schüssen zu gelangen. Diese Veränderungen haben Züge eines Niedergangs, - aber was war früher wirklich anders oder „besser“? Erfrischend ehrlich so manche Charakterisierung. Opfere der Fernsehzuschauer seinen Sonntagabend der ARD, so erlebe er alles, was unsere Welt zusammenhalte: „Zunächst den Tatort als unwiderstehliche Propaganda der Political Correctness, der, wie alle Fernsehserien, den ‚sociopleasure’ der Moralität bietet: Man kann zusehen, wie Gerechtigkeit geschieht. Und dann Sabine Christiansen – Talk als Kult unserer Staatsreligion.“
Die Welt-Korrespondentin Mariam Lau wundert sich über die „Vergrünung der Konservativen“, wobei sie mit letzteren die Union meint. Wann war diese eigentlich noch konservativ? Zutreffend jedoch diagnostiziert sie das völlige Aufgeben jeglicher Positionen durch CDU/CSU vor der Chimäre Zeitgeist, respektive dem, was man dafür fälschlicherweise hält: „Beispiel Familienpolitik. Man traut seinen Augen nicht, aber inzwischen wird ‚Gender Mainstreaming’ – das irrwitzige Ergebnis einer Fusion von Bürokratismus und philosophischer Seligsprechung der Homosexualität – ausgerechnet von der Familienministerin quasi in den Status eines Verfassungsziels erhoben.“ Die Chefkorrespondentin von Springers Flaggschiff stellt den Unionsparteien kein gutes Zeugnis aus: „Die Vergrünung der Konservativen ist umso merkwürdiger, als der gesellschaftliche Mainstream ihnen mittlerweile auf so vielen Feldern recht gegeben hat. Familie, Nation, Glaube – inzwischen sind alle drei rehabilitiert.“
Herfried Münkler befasst sich mit „Herausforderungen und Möglichkeiten“ der Außenpolitik einer souveränen „Mittelmacht“. Er weist darauf hin: „Man kann nicht fortgesetzt von Demokratisierung reden, aber die deutsche Bevölkerung von allen relevanten europapolitischen Entscheidungen fernhalten“. Hier hätte man sich vielleicht deutlichere Fragen gewünscht, was heißt denn eigentlich souverän? Ist die Bundesrepublik Deutschland es faktisch?
Friedrich Dieckmann sitzt auf der Terrasse des Operncafés Unter den Linden und lässt die nahe und weite Vergangenheit passieren. Man erfährt unter anderem Erhellendes über die allerjüngste Architekturgeschichte im Herzen Deutschlands, in Berlins Mitte.
Alle Beiträge aufzuzählen, zu würdigen gar, ist schier unmöglich. Neben dem qualitativ hohen Niveau der Beiträge besonders hervorzuheben ist, dass es gelungen ist, die verschiedensten Felder tief zu beackern. Von der Ästhetik im engeren Sinne, einschließlich der Architektur der Berliner Republik und ihren Festen, über den neuen Patriotismus, die aktuelle Generation der deutschen Topmanager bis zu ontologischen Stimmungsbildern haben die Herausgeber ihre Scheinwerfer von vielen Seiten auf diesen Staat gerichtet, von dessen Ausmaß an Neuem wir erst beginnen zu ahnen. Auch wenn man nicht mit jeder Aussage konform gehen muss, man an mancher Stelle gar noch deutlichere Worte sich hätte vorstellen können, so ist dieser Band ein Meilenstein, der markiert, wo wir stehen, was wir in den Jahren insbesondere seit 1989 geschafft und erkannt haben und was zum souveränen Staat zukünftig noch notwendig ist. Souverän ist, um mit Carl Schmitt zu sprechen, wer über den Ausnahmezustand bestimmt. Aber darüber hinaus bedarf es für wahrhafte Souveränität eines tiefen kulturellen Bewusstseins: Ohne Ästhetik ist kein Staat zu machen!
geschrieben am 03.04.2007 | 1495 Wörter | 9482 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen