Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
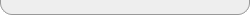
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Das Floss der Medusa
| ISBN | 3552058168 | |
| Autor | Franzobel | |
| Verlag | Zsolnay Verlag | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 592 | |
| Erscheinungsjahr | 2017 | |
| Extras | - |

Rezension von
Thomas Stumpf
Der Ăsterreicher Franzobel nimmt eine schreckliche historische Begebenheit zum Anlass fĂŒr seinen neuen, vielgelobten Roman, dessen Inhalt ich nachfolgend kurz umreiĂen möchte.
weitere Rezensionen von Thomas Stumpf

Im Jahr 1816 nimmt Frankreich den Senegal von den Briten wieder zurĂŒck in französischen Besitz. Hierzu macht sich ein Schiffskonvoi von der französischen Hafenstadt Rochefort auf nach Saint-Louis, der Hauptstadt des Senegals. Die Fregatte MĂ©duse ist neben der Loire, der Argus und der Echo eines der vier Schiffe. An Bord der MĂ©duse befinden sich 400 Menschen, davon auch 63 Passagiere, unter denen sich Frauen und Kinder befinden. Zu den Passagieren gehört auch der neue Gouverneur des Senegal, Julien-DesirĂ© Schmaltz. Das Schiff lĂ€uft am 17.06.1816 aus. GefĂŒhrt wird das Kommando auf der MĂ©duse vom vollkommen unfĂ€higen KapitĂ€n Hugues Duroy de Chaumareys, der weder ein Schiff navigieren noch Menschen fĂŒhren kann, dafĂŒr aber an einem schlimmen Reizdarm leidet und ein eitler Modegeck ist. Er ist ĂŒberzeugter Royalist, und nur dieser Tatsache hat er sein Kommando zu verdanken. Nichts ist ihm mehr zuwider als Demokratie und das einfache Volk. Trotz ausdrĂŒcklicher Warnungen vor den tĂŒckischen GewĂ€ssern, lĂ€uft die MĂ©duse auf der berĂŒchtigten Arguin-Sandbank vor der afrikanischen KĂŒste auf Grund. Das Drama nimmt seinen Lauf.
Es gibt nur sechs Rettungsboote, viel zu wenige fĂŒr 400 Menschen. Die Boote werden gewassert, aber nicht voll besetzt. Soweit finden sich Parallelen zur Tragödie der Titanic. Man kommt schlieĂlich auf die Idee, ein riesiges Floss zu bauen, auf dem weitere Personen unterkommen können. Der KapitĂ€n, der bereits als einer der Ersten die MĂ©duse verlassen hat, ordnet dies letztlich an. Die Mannschaft zerlegt gehorsam Teile der MĂ©duse und zimmert grobschlĂ€chtig ein etwa 15 x 8 m groĂes Floss zusammen. Es nimmt am Ende 147 Menschen auf, viel zu viele. Mit den Beibooten versucht man, das Floss zu ziehen, doch das geht sehr schnell schief, die Ruderer schaffen die Last einfach nicht. Man kappt die Taue und ĂŒberlĂ€sst das absolut nicht seetĂŒchtige und steuerungsunfĂ€hige Floss seinem Schicksal auf dem offenen Meer. Alsbald beginnt ein unmenschlicher Ăberlebenskampf. Als das Floss der Medusa schlieĂlich nach 13 Tagen von der Argus aufgefunden wird, haben von den anfangs 147 Menschen darauf nur 15 ĂŒberlebt. Davon sterben 5 weitere in den nĂ€chsten Wochen. Die Tragödie wird dank Schiffsarzt Savigny, einer der FlossĂŒberlebenden, bekannt und schlĂ€gt Wellen. Der Marineminister und ca. 200 Offiziere werden aus dem Dienst entlassen. KapitĂ€n Hugues Duroy de Chaumareys wird zu 3 Jahren Haft verurteilt und unehrenhaft aus dem Dienst entlassen.
Franzobel nimmt sich auf knapp 600 Seiten Zeit, die Tragödie nachzuzeichnen. Er hat intensiv die historischen Fakten zu den Ereignissen recherchiert und war sogar selbst zu den Wrackresten der MĂ©duse gesegelt, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Er muss einen enormen Aufwand fĂŒr die Verwirklichung dieses Werks betrieben haben. Die Geschichte, die er erzĂ€hlt, ist eine Sache. Die Sprache, derer er sich bedient, eine andere. Im Klappentext heiĂt es, es sei âein Epos von groĂer Kraftâ. Und das kann ich nur unterstreichen. Sprachlich ist das hervorragend, allerdings auch gewöhnungsbedĂŒrftig, da möchte ich keinen Hehl daraus machen. Es ist nun einmal ein beinahe unmögliches Unterfangen, ein Personal von 400 Menschen unterzukriegen und dabei alle noch beim Namen zu nennen. Selbst reduziert auf die wesentlichen Personen, ist das immer noch eine Menge. Franzobel bedient sich hierbei eines Kniffs: Er ĂŒberzeichnet die Figuren bis ins Groteske, beinahe hat das stellenweise schon den Charakter einer Parodie. Einzelne CharakterzĂŒge oder ĂuĂerlichkeiten werden extrem hervorgehoben und stĂ€ndig wiederholt. Es heiĂt dann z.B. nur noch âKapitĂ€n Reizdarmâ oder einer sieht aus wie Alain Delon oder einer wie Lino Ventura. Der Matrose Hosea ist der âSchwarzenegger-Typâ oder es wird darĂŒber sinniert, welcher heutige Schauspieler in einer Verfilmung welche Person spielen wĂŒrde. Der Stotterer Lozach heiĂt immer âLo-, Lo-, Lozachâ, der Jude Kimmelblatt spricht jiddisch, der schreckliche Smutje Gaines hat eine Hasenscharte, spricht nur in Zischlauten und hat ein âMaiskolbengrinsenâ und so weiter. So gelingt es Franzobel, dem Leser die Figuren geradezu ins Hirn zu brennen, so dass man immer weiĂ: Aha, das war der und der.
Das hat aber auch einen entscheidenden Nachteil: Die zahlreichen Wiederholungen ermĂŒden (âKapitĂ€n Reizdarmâ ist nur einmal witzig). Mit der Zeit denkt man sich: Ja, danke, ich habe es begriffen, das ist der und der. DarĂŒber hinaus hat dies zudem eine gewisse EindimensionalitĂ€t der Figuren zur Folge und aufgrund der stark hervorgehobenen oberflĂ€chlichen Attribute, nimmt man sie weniger als Menschen als vielmehr als abstrakte Prinzipien wahr, was zu einer emotionalen Distanz fĂŒhrt. In âDas Floss der Medusaâ lĂ€sst ein hĂ€ssliches ĂuĂeres immer auch auf ein hĂ€ssliches Inneres schlieĂen. Das ist ein wenig zu offensichtlich, aber ich nehme an, dass das Absicht ist. Von der Figurenzeichnung her kommt man menschlich nur wenigen nah. Dem jungen Viktor etwa oder dem Schiffsarzt Savigny. SympathietrĂ€ger gibt es ohnehin nur sehr wenige, etwa der Matrose Hosea. Die wenigen Frauen kommen generell nicht so gut weg. Sie sind entweder herrisch und anmaĂend (âCharliiie!!!â) oder obszön-bedrohlich (âSie nimmt ihn in den Mundâ) oder einfach nur hĂŒbsch, aber dumm.
Franzobel hat sich auĂerdem bei seiner Umsetzung dafĂŒr entschieden, keinen historischen Roman im herkömmlichen Sinn zu schreiben (den ich, ehrlich gesagt, lieber gelesen hĂ€tte). Er benutzt einen auktorialen ErzĂ€hler, der sich immer wieder einschaltet und die Ereignisse oder Handlungsweisen aus der heutigen Zeit kommentiert oder belehrt oder Vergleiche zieht, etwa mit der FlĂŒchtlingskatastrophe auf dem Mittelmeer. Kann man so machen, die erzielte Wirkung ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch bin ich als Leser durchaus in der Lage, meine SchlĂŒsse selbst zu ziehen, diesen Freiraum hĂ€tte ich gerne gehabt. Zudem geht dieses Vorgehen an den meisten Stellen zu Lasten der aufgebauten AtmosphĂ€re, die dadurch immer wieder gebrochen wird und das manchmal sogar recht plump. Etwa wenn eine Frau auf dem Floss bei einer âSĂ€uberungsaktionâ enthauptet wird und ich plötzlich an der Stelle lesen muss wie ihr Kopf âwie in einem asiatischen Slapstick B-Movieâ durch die Gegend fliegt. Was soll das, bitte? Die besagte SĂ€uberungsaktion, die so ziemlich zum Ende des Buchs passiert, nachdem bereits alle Menschlichkeit ĂŒber Bord ist und man schon seit Tagen Leichen isst, stellt einen absoluten moralischen Tiefpunkt dar. Man entscheidet sich auf dem Floss unter den letzten Ăberlebenden dazu, diejenigen, die zu schwach sind, einfach zu töten und ins Wasser zu werfen, damit die Ăberlebenschancen fĂŒr die anderen noch um ein paar Tage steigen. Dann so eine Formulierung? Völlig fehl am Platze. Solche Stellen finden sich hĂ€ufiger.
Franzobel hat sich das erforderlich nautische Vokabular angeeignet, sich mit BrĂ€uchen und Gewohnheiten und dem Soziolekt der Seeleute der damaligen Zeit auseinandergesetzt und glĂ€nzt mit einer Menge Wissen und Zeitkolorit. Dieses RĂŒstzeug kommt seinen Beschreibungen zugute und der Leser profitiert davon. Es geht auf dem Schiff nicht zimperlich zu. Die Unmenschlichkeiten und Grausamkeiten offenbaren sich nicht erst auf dem Floss. Von Anfang an wird damit nicht gespart, da wird schon mal jemand zu Tode gepeitscht. Auf dem Floss wird dann der Mensch auf seinen rohen Kern reduziert, frei nach Brecht: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Oder, wie es wörtlich im Buch heiĂt: "Wo es kein Brot gibt, gibt es kein Gesetz mehr. Jetzt ist es also so weit, der Mensch zeigt seinen Kern, das, was sich hinter der Schminke der Moral und unter der Haut der Kultur verbirgt, das wilde Tier."
Zu Beginn und am Ende des Buchs dreht sich einiges um einen jungen Mann, Viktor, der auf der MĂ©duse anheuert, um aus seiner kleinen bĂŒrgerlichen Welt zu entkommen. Doch kaum an Bord, wird er vom sadistischen Smutje Gaines und dessen Adlatus misshandelt und drangsaliert. Sie drĂŒcken ihm das Gesicht an den glĂŒhend heiĂen Ofen und schlagen ihn halb bewusstlos. Der hasenschartige Gaines ist der Erste, der spĂ€ter auf dem Floss Menschenfleisch essen wird. Zudem geistert die britische Sagenfigur des âDavy Jonesâ durch das ganze Buch, eine Art Klabautermann, die Personifizierung des nassen Seemannsgrabs. Und vielleicht war er es, der den bösartigen Smutje am Ende geholt hat.
Richtig grausam wird es dann auf dem Floss. Da wird gehackt und geschnitten, es rollen Köpfe und GliedmaĂe, flieĂt das Blut, fressen Haie Menschen, fressen Menschen Menschen, wird Urin getrunken. Und vieles mehr.
Doch das ist nicht alles. Franzobel zeichnet mit dem Schicksal der Medusa zugleich ein Bild von der französischen Nation zur maĂgeblichen Zeit. Die âGrande Nationâ wird gnadenlos seziert und ihre Unmenschlichkeit offenbart. Alles geschieht im Namen Frankreichs. Man will sogar die Guillotine auf einem Beiboot mitnehmen, die französische Gerechtigkeit darf ja nicht verloren gehen. Sie versinkt aber im Meer. Die gesamte Nation erleidet hier Schiffbruch. Der französische Maler ThĂ©odore GĂ©ricault erschuf ein GemĂ€lde nach dieser Katastrophe mit dem Titel âLe Radeau de la MĂ©duseâ - âDas Floss der Medusaâ. Als GĂ©ricault es 1819 ausstellte, war die Resonanz ernĂŒchternd bis vernichtend, denn keiner wollte an das Versagen Frankreichs in dieser schrecklichen Sache erinnert werden. Das Bild hĂ€ngt heute im Pariser Louvre.
Mein Fazit:
Ein starkes, heftiges Buch mit vielen beeindruckenden Bildern und sprachlichen Höhepunkten ĂŒber eine furchtbare historisch belegte Tragödie. Fakten und Fiktion werden gut gemischt. Die Sprache ist kraftvoll und archaisch. Auf dem Floss prallen dann Oberschicht (die Offiziere, die Personifizierung des französischen Staats) und Unterschicht aufeinander und tragen dort, stellvertretend komprimiert auf das Floss, ihren staatlichen Klassenkampf aus. Ressentiments, Rassismus und Antisemitismus sind nur einige der Begleiterscheinungen. Erheblich gestört haben mich die vielen Wiederholungen und vor allem der vermaledeite auktoriale ErzĂ€hler, der unnötig zu BrĂŒchen in der AtmosphĂ€re und im Spannungsaufbau gefĂŒhrt hat und der mir zudem manchmal zu oberlehrerhaft und zu plump war. DafĂŒr gibt es von mir einen klaren Punktabzug. Ich denke lieber selbst beim Lesen.
geschrieben am 12.03.2018 | 1571 Wörter | 9059 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen