Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Projekt Europa Eine kritische Geschichte
| ISBN | 3406727689 | |
| Autor | Kiran Klaus Patel | |
| Verlag | C.H.Beck | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 463 | |
| Erscheinungsjahr | 2018 | |
| Extras | - |
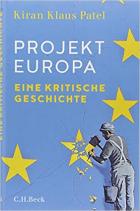
Rezension von
Dr. Sebastian Felz
Alles begann mit einer Briefmarke. Kiran Klaus Patel, heute Professor fĂŒr EuropĂ€ische und Globale Geschichte an der UniversitĂ€t Maastricht, fieberte 1982 als ZehnjĂ€hriger einer Sondermarke der Deutschen Bundespost entgegen. FĂŒr den Mai 1982 war eine Gedenkmarke zum Jahrestag der Römischen VertrĂ€ge angekĂŒndigt worden. Der junge historisch interessierte Patel freute sich auf eine Briefmarke mit einem Motiv aus der Zeit des âimperium romanumâ. Umso enttĂ€uschter war er, als zum 25-jĂ€hrigen JubilĂ€um der GrĂŒndungsvertrĂ€ge der EuropĂ€ischen Wirtschaftsgemeinschaft nur die Namen der vertragsschlieĂenden StaatsoberhĂ€upter sowie Nationalflaggen der Vertragsstaaten auf dem Postwertzeichen fĂŒr 60 Pfennige zu sehen war.
weitere Rezensionen von Dr. Sebastian Felz

Mit diesem (oft ernĂŒchternden Abgleich) von Vorstellung und Wirklichkeit arbeitet auch Patels Analyse der Entwicklung der EG/EU in den letzten sechs Jahrzehnten. âEuropa und die europĂ€ische Integrationâ, âFrieden und Sicherheitâ, âWirtschaftswachstum und Wohlstandâ, âPartizipation und Technokratieâ, âWerte und Normenâ, âBĂŒrokratisches Monster oder nationales Instrumentâ sowie die âGemeinschaft und die Weltâ sind die acht Schritte dieser AnnĂ€herung ĂŒberschrieben.
ZunĂ€chst widmet sich Patel dem institutionellen Umfeld der EuropĂ€ischen Gemeinschaften in den 1950er-Jahren. Ende der 1940er bzw. Anfang der 1950er-Jahre war die EuropĂ€ische Gemeinschaft fĂŒr Kohle und Stahl eine unter vielen supernationalen Organisationen in Europa. Die Wirtschaftskommission fĂŒr Europa (UNECE), die OECD oder der Europarat wĂ€ren als Beispiele zu nennen. Insgesamt kĂŒmmerten sich ca. 20 ZusammenschlĂŒsse um die wirtschaftliche Entwicklung im Nachkriegseuropa. Die Montanunion war eine der kleinsten ĂŒberstaatlichen ZusammenschlĂŒsse. Die EGKS entstand 1951, also zu einer Zeit, in der der beginnende Kalte Krieg die SpielrĂ€ume in Europa verengte. Im Gegensatz zu anderen internationalen Organisationen war die 1949 gegrĂŒndete Bundesrepublik Deutschland GrĂŒndungsmitglied der EGKS. DafĂŒr fehlten aber die skandinavischen LĂ€nder und das Vereinigte Königreich.
1957 kam die EuropĂ€ische Wirtschaftsunion und Euratom hinzu. Allerdings scheiterten 1954 durch das Votum der französischen Nationalversammlung die EuropĂ€ische Verteidigungsgemeinschaft und die EuropĂ€ische Politische Gemeinschaft. In einer Art zweiten âEGâ fanden sich 1960 die Schweiz, Ăsterreich, GroĂbritannien und die skandinavischen LĂ€nder zur EuropĂ€ischen Freihandelsassoziation (EFTA) zusammen.
Was aber waren die entscheidenden Faktoren, welche die EG zur bestimmenden Kraft in Westeuropa seit den 1970er-Jahren werden lieĂ? Patel identifiziert derer drei. ZunĂ€chst die Konzentration auf die Zollunion und den Binnenmarkt. Die Herstellung eines Binnenmarktes wirkte auch auf andere Politikbereiche harmonisierend. Berufsausbildungen. soziale Sicherungssysteme, Umweltschutz und technische Standards mussten, wenn auch in unterschiedlichem MaĂe, angepasst werden. SchlieĂlich entwickelte sich wegen des Zusammenbruchs des internationalen WĂ€hrungssystems von Bretton-Woods 1973 die Idee einer WĂ€hrungsunion.
Ein besonderer Bereich der vergemeinschaften Politik war und ist der Agrarsektor. Die protektionistische Politik verbunden mit hohen Subventionen stuft Patel als eine besondere Art der Sozialpolitik ein. Die Landwirtschaft wurde behutsamer durch den Strukturwandel in der zweiten HĂ€lfte des 20. Jahrhunderts gefĂŒhrt als beispielsweise die europĂ€ische Textilindustrie.
Ein weiterer wichtiger Integrationsfaktor war das Recht. Patel spricht hier von einer âMikrophysik des Rechtsâ, nach deren Kraftlehre die einzelnen Wirtschaftsakteure mit der Durchsetzung der Grundfreiheiten (Waren, Dienstleistungen, Arbeitnehmer und Kapital) zu Agenten der Integration mithilfe der Rechtsprechung des EuropĂ€ischen Gerichtshofes wurden. Schon 1963 judizierte das Gericht, dass das Recht der Gemeinschaft eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts darstelle, auf die sich auch der einzelne BĂŒrger berufen könne (van Gend & Loos). Ein Jahr spĂ€ter entschied das Gericht, dass das Gemeinschaftsrecht Anwendungsvorrang vor den nationalen Rechtsordnungen genieĂe (Costa vs. Enel). Den zweiten Schub bekam die europĂ€ische Integration durch die Fortbildung des Gemeinschaftsrechts in den 1970er-Jahren. Der EuGH entschied 1979, dass ein Erzeugnis (hier Johannisbeerlikör) im Binnenmarkt frei gehandelt werden kann, wenn es in einem Mitgliedstaat rechtmĂ€Ăig in Verkehr gebracht worden war (Cassis de Dijon). Schon 1974 hatten die Richter in Luxemburg klargestellt, dass jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsĂ€chlich oder potentiell zu behindern, als handelsbeschrĂ€nkende MaĂnahme anzusehen sei (Dassonville).
Einen weiteren Schub gab das Recht der europĂ€ischen Integration im Bereich der Produktsicherheit und des Arbeitsschutzes. Die âNeue Konzeptionâ der 1980er-Jahre strebte keine Detailharmonisierung von Produkten mehr an, da diese nur in langwierigen Verfahren in Rechtsaktform gebracht werden konnte, sondern der europĂ€ische Gesetzgeber formulierte in Richtlinien Mindeststandards, welche durch technische Standards in Form von Normen ausgefĂŒllt werden sollten. Damit wurde ein Verfahren geschaffen, das sehr viel schneller auf den technischen Fortschritt reagieren konnte.
Neben der Konzentration auf das Feld der Wirtschaft und den gĂŒnstigen rechtlichen Wirkungen auf die Integration hebt Patel vor allem die groĂen finanziellen Ressourcen als entscheidenden Vorteil fĂŒr die EG hervor. Der Haushalt der EG war im Gegensatz zu den finanziellen Mitteln der OECD oder des Europarates beachtlich.
In Bezug auf ihre Funktion als Friedensmacht ist das Urteil von Patel gespalten. Er verweist darauf, dass die Gemeinschaft im Kalten Krieg eindeutig zum westlichen Block gehörte. Blockfreie Staaten, wie z. B. Ăsterreich, traten erst nach 1990 der EG/EU bei. WĂ€hrend des BĂŒrgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien brachten die âEuropĂ€erâ keine friedensstiftende Initiative zustande. Jedoch darf, dies unterstreicht Patel ausdrĂŒcklich, die Wirkung des âBinnenfriedensâ unter den Mitgliedstaaten nicht unterschĂ€tzt werden.
Was die Wirtschaftspolitik der EuropÀischen Gemeinschaft als Wohlstandsfaktor angeht, so konstatiert Patel, dass es viele Behauptungen, aber wenige Beweise dazu gibt. Patel kann aber zeigen, dass nach dem Nachkriegswirtschaftsboom, der in den 1970er-Jahre zu Ende ging, die EG eine stabilisierende Wirkung hatte. Andernfalls wÀre der Abschwung noch stÀrker ausgefallen.
In den Zeiten des bevorstehenden Brexits sind insbesondere die Passagen ĂŒber die âAustritteâ von Algerien (1962) und Grönland (1985) aus der Gemeinschaft ĂŒberraschend und hochinteressant. Ein Austritt, so Patel, sei mitnichten mit einem RĂŒckgewinn an SouverĂ€nitĂ€t gleichzusetzen, denn auf den Austritt folgte ein dichtes Geflecht von NachfolgevertrĂ€gen und fortgesetzten wirtschaftlichen Beziehungen.
Soweit sich die EU als Wertegemeinschaft verstehe (vgl. Artikel 2 EUV), so zeigt Patel eindrucksvoll an den Assoziierungsverhandlungen mit den Diktaturen Spanien und Griechenland in den 1950er- und 1960er-Jahren sowie den Verhandlungen mit den âEntwicklungslĂ€ndernâ, ĂŒberwiege die ârealpolitischeâ Seite der Gemeinschaft die werteorientierte Politik.
SchlieĂlich beschreibt Patel die facettenreichen Beziehungen der Gemeinschaft zu den USA, Japan, China und Afrika in hĂ€ufig ĂŒberraschenden Perspektiven. Kiran Klaus Patel zeigt, dass manche Grundannahmen revidiert werden mĂŒssen, und einige gegenwĂ€rtige Probleme schon frĂŒheren Generationen vertraut waren und von ihnen gelöst wurden. Ein historisch-analytischer Kassensturz der Vergangenheit, der gegenwĂ€rtig helfen kann, die Zukunft der Union zu gestalten.
geschrieben am 10.03.2019 | 988 Wörter | 6908 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen