Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
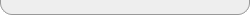
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Die Neuordnung der Rechtsbeziehungen zwischen Ärzten und Krankenkassen durch das Berliner Abkommen
| ISBN | 3848719487 | |
| Autor | Anna Käsbauer | |
| Verlag | Nomos | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 408 | |
| Erscheinungsjahr | 2015 | |
| Extras | - |

Rezension von
Dr. Sebastian Felz
Im fünften Buch des Sozialgesetzbuches wird in § 72 Abs. 1 S. 1 das Zusammenwirken von Ärzten und Krankenkassen festgeschrieben. Wichtigstes Gremium dafür ist der „Gemeinsame Bundesausschuss“, der für ungefähr 70 Millionen gesetzlich krankenversicherte Bürger den Leistungsanspruch durch Richtlinien definiert (§ 91 SGB V), was verfassungsrechtlich umstritten ist. Zulassungsausschüsse (§§ 95ff. SGB V) oder Bundesmantelverträge (§§ 82ff. SGB V) sowie das Schiedsamt (§ 89 SGB V) sind weitere Gremien und Instrumente, welche die gemeinsame Selbstverwaltung im Krankenkassenrecht festlegen. Aber warum ist das so? In ihrer an der Universität Regensburg verfassten und mit dem Dissertationspreis der „Gesellschaft zur Förderung der sozialrechtlichen Forschung e. V.“ ausgezeichneten Doktorarbeit geht Anna Käsbauer den historischen Ursprüngen sowie den nachmaligen Entwicklungen dieses Kooperationsverhältnisses nach. Die erste Achse dieser Untersuchung beginnt mit dem „Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter“ von 1883 und läuft über das „Krankenversicherungsgesetz“ 1892 und die Reichsversicherungsordnung von 1911 auf das Berliner Abkommen von 1913 zu. In diesen 30 Jahren waren die privatrechtlichen Verträge zwischen Krankenkassen und Ärzten durch Verhandlungsmacht der Krankenkassen geprägt. Die Ärzteschaft reagierte darauf mit einer Institutionalisierung ihrer Interessenvertretungen („Hartmannbund“) und Streiks. Sowohl die politischen als auch die rechtswissenschaftlichen Diskurse zur Kassenarztproblematik zeichnet Käsbauer minutiös nach. Konstruktiv sind vor allem die Darstellung der juristischen Diskussion über die Vergleichbarkeit der Rechtsstellung des Kassenarztes zum „normalen“ Arbeitnehmer und die Frage nach der Anwendung dogmatischer Figuren des Tarifvertragsrechts für die Verträge zwischen Krankenkassen und ihren Ärzten.
weitere Rezensionen von Dr. Sebastian Felz

Das Berliner Abkommen vom 23.12.1913 war der erste große Versuch, die vertragsrechtlichen Beziehungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und denen der Ärzte mit staatlicher Hilfe zu systematisieren. Es wurden weniger inhaltliche Festsetzungen getroffen, sondern die Vertragsparteien hofften durch Verfahrens- und Organisationsbestimmungen, Interessen ausgleichen und Konflikte entschärfen zu können. Dazu gehörten insbesondere die Einrichtung von paritätisch besetzten Vertragsausschüssen für die Vorgaben des Inhalts von Einzelverträgen, die Einrichtung eines Zentralausschusses für Ärzte und Krankenkassen zur Beschlussfassung von Richtlinien über Zulassungskriterien und Vertragsinhalte sowie die Aufhebung der Zulassungsautonomie der Krankenkassen durch das Führen von Arztregistern mit einer Auswahlentscheidung durch paritätisch besetzte Registerausschüsse. Der Zentralausschuss hatte auch das Recht, die Durchführung des Abkommens sicherzustellen, das Abkommen zu ändern und als schiedsgerichtliche Instanz zu fungieren. Hier saßen neben Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenkassen auch Unparteiische, die vom Staatssekretär des Inneren und vom preußischen Handels- bzw. Innenministerium ernannt wurden. Mit diesem privatrechtlichen Vertrag und dessen öffentlich-rechtlicher Umrahmung beginnt eine spezifische Rechtsentwicklung im Krankenkassenrecht, das – mit den Schlagworten „regulierter Selbstregulierung“ und „Multinormativität“ benannt – eine Hybridstruktur zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht erhalten hat. Diese Strukturen werden in der Weimarer Republik durch die „Verordnung über Ärzte und Krankenkassen“ 1923 und das neue Kassenarztrecht 1931/32 durch die Stärkung der Verbände und die Möglichkeit, im Reichsausschuss (seit 1924) in bestimmten Fällen Richtlinien auch mit Wirkung für die Versicherten zu erlassen, noch vertieft.
Für die heutige Diskussion über das Verhältnis Staat zur Selbstverwaltung der Krankenkassen und Ärzteschaft macht Käsbauer die Unterscheidung zwischen „politischer“ und „juristischer“ Selbstverwaltung fruchtbar. Mit Rückgriff auf die Verwaltungsrechtswissenschaft der Weimarer Republik definiert sie „juristische Selbstverwaltung“ als Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch die Betroffenen in gegenüber dem Staat verselbstständigten öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, während bei „politischer Selbstverwaltung“ Privatpersonen und staatliche Behördenvertreter in einer Verwaltungseinheit zusammenwirken. Auch nach dem „Gesetz über Kassenarztrecht“ von 1955, das eine Neujustierung dieses Rechtsfeldes in Richtung einer (atypischen) juristischen Selbstverwaltung brachte, waren die Beziehungen zwischen den Kassen und ihren Ärzten durch Kooperationsstrukturen mit großem staatlichen Einfluss geprägt. Wenn der Gesetzgeber und die Rechtswissenschaft die historischen Entwicklungen von Rechtsgebieten als „Problemerkenntnis- und nicht als Rechtsquelle“ begreifen, kann aus den spezifischen Selbstverwaltungsstrukturen im Kassenarztrecht auch für die gegenwärtigen Herausforderungen entweder durch Anwendung des bestehenden Wettbewerbs- oder Vergaberechts oder die Entwicklung eines eigenen „Gesundheitsregulierungsrechts“ gelernt werden. Die Studie von Anna Käsbauer liefert dazu genügend Material.
geschrieben am 06.05.2021 | 609 Wörter | 4678 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen