Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Ernst Jünger
| ISBN | 3886808521 | |
| Autor | Helmuth Kiesel | |
| Verlag | Siedler | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 716 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | gebundene Ausgabe |
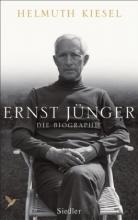
Rezension von
Jan Robert Weber
Der Heidelberger Literaturwissenschaftler Helmuth Kiesel hat eine gediegene Biographie ├╝ber Ernst J├╝nger geschrieben, die sich durch profunde literarhistorische wie geistesgeschichtliche Kontextualisierung sowie ├╝berzeugende Interpretation des J├╝ngerschen Gesamtwerks auszeichnet. Kiesel stellt J├╝nger als einen Autor der ÔÇ×reflexiven ModerneÔÇť vor.
weitere Rezensionen von Jan Robert Weber

In zehn Kapiteln legt er dar, dass J├╝nger durch das Fronterlebnis des Ersten Weltkriegs aus seiner b├╝rgerlichen ÔÇ×GeborgenheitÔÇť geworfen wurde, dann in der Weimarer Republik als schriftstellernder Milit├Ąr und nationalrevolution├Ąrer Publizist den langen Weg k├╝nstlerischer Selbstfindung ging, ehe er um 1930 seine Rolle als Autor fand. Diese Selbstfindung machte ihn immun gegen jegliche ideologischen Vereinnahmungsversuche. Mit gro├čem Aufwand an Textbelegen, literaturgeschichtlichen Querverweisen und biographisch-historischen Fakten hat Kiesel diese Entwicklung vom Engagement zum ÔÇ×DesengagementÔÇť beschrieben: Er braucht daf├╝r mehr als die H├Ąlfte seiner 670 Seiten. Dabei macht der Heidelberger Literaturporfessor aus dem Werk heraus verst├Ąndlich, warum J├╝nger nach der so genannten Machtergreifung 1933 kein Mitl├Ąufer des Hitler-Regimes wurde: Die Autorschaft war im Kern auf Distanz zum Zeitgeschehen angelegt. Sie wurde aus der Beobachterposition des ÔÇ×verlorenenen PostensÔÇť entwickelt und kam auch nach 1945 aus dieser ÔÇ×VerteidigungsstellungÔÇť nicht heraus.
Als roten Faden des Oeuvres macht Kiesel den literarisch gef├╝hrten Moderne-Diskurs kenntlich. J├╝nger verstand die Moderne im Sinne Max Webers als einen Vorgang unwiderruflicher Entzauberung. Einen linearen Fortschritt vermochte der Schriftsteller nicht zu sehen, eher war es eine zyklisch-spiralf├Ârmige Bewegung, die er im turbulenten Geschehen seines Jahrhunderts ausmachte. Zivilisatorische R├╝ckf├Ąlle wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die NS-Diktatur, aber auch die zunehmende Umweltverschmutzung hat er daher mit einer eigent├╝mlichen Mischung aus Trauer und Zuversicht kommentiert. Modernisierung begriff J├╝nger als nihilistischen Reduktionsprozess, der sich eines fernen Tages ÔÇô den der Autor ├╝brigens mehrmals als kurz bevorstehend angab ÔÇô in sein Gegenteil umkehren w├╝rde. In jedem selbst erlebtem Untergang vermochte J├╝nger das ÔÇ×Rettende auchÔÇť (nach H├Âlderlin) zu erblicken. Aus dieser ÔÇ×stereoskopischenÔÇť Perspektive, die Kiesel mit dem Begriff der Ambivalenz erkl├Ąrt, hielt J├╝nger Modernisierung f├╝r ebenso unaufhaltsam wie notwendig.
Eine Biographie ├╝ber Ernst J├╝nger hat bislang gefehlt, obwohl die B├╝cher ├╝ber ihn mittlerweile etliche Regalmeter f├╝llen. Das ereignisreiche, wechselvolle und mitunter abenteuerliche Leben dieser schillerndern Schriftsteller-Pers├Ânlichkeit zu beschreiben, ist keine leichte Aufgabe. Kiesel hat sie ÔÇô mit Abstrichen ÔÇô gel├Âst. Seit 1999 wird J├╝ngers Nachlass im Marbacher Literaturarchiv verwahrt, bestehend aus Manuskripten, Notizb├╝chern und unz├Ąhligen Briefen. Diesen Nachlass hat Kiesel offenbar zur Kenntnis genommen, aber seine Ausf├╝hrungen st├╝tzen sich vornehmlich auf das bislang Ver├Âffentlichte. Das ist eine vertane Chance. Um J├╝ngers exemplarisches wie exzeptionelles Leben nachzuzeichnen, ist es notwendig, die reichhaltigen au├čerliterarischen Quellen sprechen zu lassen. Kiesel verl├Ąsst sich allzu sehr auf das literarische Werk als Lebenszeugnis, obwohl dieses doch prim├Ąr als bewusst gesteuerte Selbstinszenierung zu verstehen ist. J├╝ngers 22-b├Ąndiges Werk ist durch und durch autobiographisch, und aus diesem Grund m├╝ssten Werk und Leben konsequent abgeglichen, m├╝sste J├╝ngers Biographie vornehmlich aus Quellen, Dokumenten und zeitgen├Âssischen ├ťberlieferungen profiliert werden. Das ist nur ansatzweise geschehen. Um die Biographie, wie der Untertitel suggeriert, handelt es sich nicht.
Wohltuend ist allemal, wie Kiesel die ideologischen Gr├Ąben ├╝berspringt, in denen von 1945 bis in die j├╝ngere Vergangenheit zahlreiche Auslegungsk├Ąmpfe um J├╝nger gef├╝hrt wurden. Mit fachm├Ąnnischer Souver├Ąnit├Ąt entkr├Ąftet der Biograph die altbekannten Schlagworte aus der Zeit des Kalten Krieges ÔÇô ÔÇ×Wegbereiter des Dritten ReichsÔÇť, ÔÇ×Ideenlieferant der Neuen RechtenÔÇť ÔÇô und bleibt abgewogen im Urteil. Dass J├╝nger einer der ersten deutschen Schriftsteller war, der die Kriegsbverbrechen an der Ostfront benannte, d├╝rfte viele noch heute ├╝berraschen. Im Werk steht es seit 1949. Kiesels Biographie setzt daher Ma├čst├Ąbe. Dabei ist seine Lebensdarstellung gut lesbar und enth├Ąlt sich der ├╝blichen Zugest├Ąndnisse an das wissenschaftliche Schreiben, das meist nur ein anderes Wort f├╝r schlechten Stil ist.
geschrieben am 05.10.2007 | 586 Wörter | 4091 Zeichen
Rezension von
Daniel Bigalke
Der Fr├╝hvollendete und Germanist Eugen Gottlob Winkler schrieb vor seinem Suizid 1936: ÔÇ×B├╝cher bilden uns allgemach eine Welt, die abseits und nur f├╝r sich besteht als eine gewaltige Aufbewahrungsst├Ątte von M├Âglichkeiten des Geistes, deren Kenntnis uns f├╝r die Anforderungen eines seltsam neu und anders empfundenen Lebensbereiches nur wenig Hilfe zu bringen scheint.ÔÇť (Eugen Gottlob Winkler, Ernst J├╝nger und das Unheil des Denkens, 2008, S. 6) Es handelt sich hier um eine Erkenntnis aus einem Buche, welches er ├╝ber Ernst J├╝nger schrieb. Wie kaum einem anderen gelang es Ernst J├╝nger in der Tat, mit seinen B├╝chern eigene Welten zu schaffen, die Seele des Lesers seiner Zeit anzusprechen. So schlussfolgert Winkler in seiner kleinen Schrift schon sehr fr├╝h: ÔÇ×Wir brauchen Ernst J├╝ngerÔÇť. (ebd.)
weitere Rezensionen von Daniel Bigalke

Die vorliegende Biographie befasst sich mit dem Ph├Ąnomen J├╝nger und stellt die vielen Facetten seines Werkes heraus, die sich niemals in ein einziges Schema einordnen lassen. Praktizierte J├╝nger einst selbst die stereoskopische Lekt├╝re seiner favorisierten Autoren, d.h. das vielseitige Querlesen und Abgewinnen allseits n├╝tzlicher Komponenten in jedem Buch ohne ideologische Vorbehalte, so ist der heutige Leser ebenso aufgefordert, eine integrale Lesekompetenz an den Tag zu legen, um J├╝ngers komplexes Werk zu erfassen und zu verstehen ÔÇô aus sich selbst heraus, ohne den oberfl├Ąchlichen Verurteilungen anheim zu fallen. Daf├╝r eignet sich die Biographie Kiesels, die nicht trennt, sondern Ernst J├╝nger und den potentiellen Leser verbindet. Das stereoskopische Lesen vereint alle Gegens├Ątze. J├╝nger selbst nannte diese Sichtweise "stereoskopisch". Der stereoskopische Leser beobachtet den Text, schafft sich eine vom momentanen Abbild des Textes abstrahierende Anschauung und gewinnt damit eine dialektische Optik, die ein und derselben literarischen Konfiguration zugleich zwei Sinnesqualit├Ąten abgewinnen kann. Der Leser agiert mehrdimensional, erstellt Verkn├╝pfungen zu bisher Gelesenem und erfa├čt den Inhalt der Lekt├╝re komplement├Ąr.
So ist nun auch das vorliegende Buch Kiesels einmalig: Es betrachtet das Werk J├╝ngers als Ausdruck eines Lebens und ordnet es entsprechend sinnvoll in die Zusammenh├Ąnge, in denen es sich entfaltete, ein. Kiesel ├╝bernimmt dabei die Perspektive Walter Benjamins und absolviert damit die Darstellung bisher derartig nicht dargebrachter Dimensionen. Interessant sind die Abbildungen (484-485): Fr├╝hsommer 1940 ÔÇô J├╝nger als Kompanief├╝hrer auf dem Vormarsch ├╝ber Sedan in Richtung Paris. Kiesel schreib hier, da├č dies die Zeit war, in der der Schriftstellerkollege Walter Benjamin in Richtung Lissabon auswich. Die Kunst des Buches besteht darin, jene Fakten zu benennen, ohne ideologisch zu urteilen. Und in der Tat kann man dem Wege Benjamins und J├╝ngers mehr abgewinnen, als den bisher reproduzierten Begriffsschrott deutscher Nachkriegsdemokraten: Benjamin beispielsweise wurde nicht von den Nationalsozialisten in den Tod in Richtung Spanien gehetzt, sondern hatte seit jeher eine suizidale Affinit├Ąt und Abgeneigtheit dem Leben gegen├╝ber, in dem er stets nach fester Ordnung und Orientierung suchte und diese nicht fand ÔÇô lange vor dem Krieg. Was J├╝ngers ├Ąsthetizistische Metaphorisierung des Krieges angeht, so kann auch diese nicht ideologisch kritisiert werden, wenn man bedenkt, da├č die totale Ideologisierung in J├╝ngers Zeit objektive G├╝ltigkeit besa├č. Und ist man ehrlich, so wird vielerlei Urteilen der Gegenwart in zehn Jahren wiederum als Ideologie und tempor├Ąre Erscheinung entlarvt werden k├Ânnen.
Kiesel betont richtig, da├č es eben nicht so einfach sei, ÔÇ×ein geradezu pathologisch wirkendes Szenarium zu beschreiben, in welchem in einem Klima der Unverantwortlichkeit ein ideologisch oder mentalit├Ątsm├Ą├čig begr├╝ndeter Zwang herrschte und einen Automatismus entstehen lie├č, der die politischen Akteure (...) gleichsam zu Marionetten machte und gro├če Teile der Bev├Âlkerung applaudieren lie├č.ÔÇť (182) Daran hat sich nichts ver├Ąndert ÔÇô bis heute. Es herrscht immer die vom Mitl├Ąufertum getragene normative Kraft des jeweils Faktischen, die sich aber immer dynamisch verh├Ąlt. Nichts ist wahr, nur weil es gerade als unerbittlich wahr dargestellt wird. Und so gibt es die Erkennenden und die Mitl├Ąufer. Jene behalten recht und stehen aus ├ťberzeugung au├čen vor, die anderen behalten stets Unrecht, bleiben aber die stets opportunistisch Agierenden und vorteilhaft Integrierten innerhalb jener Strukturen, die sich regelm├Ą├čig selbst er├╝brigen, obwohl sie vorher f├╝r dauerhaft wahr gehalten wurden. Wie dem auch sei.
Kiesels Buch ist von einer Kraft gepr├Ągt, die viele Denk-Konstellationen beim Leser entfacht. Das Buch fordert zur dialektischen Optik beim Lesen J├╝ngers heraus und praktiziert diese Optik in sich selbst. Es zeigt aber auch gerade damit, da├č es eine Biographie mit werkbiographischem Schwerpunkt ist, die angesichts der Komplexit├Ąt j├╝ngerscher Denkwelt nicht das letzte Wort sein kann, das ├╝ber das Werk Ernst J├╝ngers m├Âglich ist.
geschrieben am 29.03.2008 | 707 Wörter | 4372 Zeichen
Rezension von
Matthias Pierre Lubinsky
Was war Ernst J├╝nger? Krieger, Waldg├Ąnger, Anarch? Oder Dandy? Man k├Ânnte auch fragen: Wer war Ernst J├╝nger? Dieser deutsche Schriftsteller, eine Ausnahmepers├Ânlichkeit in jeglicher Hinsicht.
weitere Rezensionen von Matthias Pierre Lubinsky

IN SEINEM MUT. Er wuchs unter dem Druck eines strengen und rationalen Vaters auf, der an seinen ├Ąltesten Sohn einige Erwartungen hatte. Der hingegen war ein miserabler Sch├╝ler, ein Tr├Ąumer, ein unverbesserlicher Romantiker. Anstatt dem Unterricht zu folgen, las er unter der Schulbank Reiseberichte ├╝ber Afrika. Da war es nur logisch, dass er sich zur Fremdenlegion absetzte. Kaum in Sidi-Bel-Abb├Ęs angekommen, zog es ihn schon wieder zur Flucht. Dann der Erste Weltkrieg. Hier konnte er beweisen, wie sehr er die b├╝rgerliche Welt ablehnte. Er war radikal in seinem Kampfesmut, vielleicht gar in seiner Todessehnsucht. Seinem Bruder Friedrich-Georg rettete er unter Gefahr seines eigenen dessen Leben. Die von ihm beschriebenen Notizhefte bildeten die Grundlage sp├Ąterer Weltliteratur: ÔÇÜIn StahlgewitternÔÇÖ.
IN SEINEM ├äSTHETIZISMUS. Meist ├╝bersehen wird J├╝ngers Affinit├Ąt zum Sch├Ânen. Er studierte genauestens die gro├čen Dandys George Bryan Brummell, Oscar Wilde, Stendhal und war nicht zuletzt selbsterzogener Sch├╝ler der gro├čen Theoretiker des Dandytums Charles Baudelaire ÔÇô und Friedrich Nietzsche. J├╝ngers Einstellung zum DANDYSME ÔÇô wie zu vielen anderen Dingen ÔÇô ├Ąnderte sich im Laufe seines Lebens. W├Ąhrend seiner Arbeit an der Rivarol-Studie war er der Auffassung, der Dandy verharre in einem Vorraum, bliebe eine Art Puppe, weshalb ihm im Alter etwas Unfertiges, Unerf├╝lltes anhafte. ÔÇ×Das f├Ąllt an Brummell, P├╝ckler, Pelham auf. Im Dorian Gray hat Wilde das literarische Muster gezeichnet: die goldene, unver├Ąnderliche Maske ├╝ber den Schrecken des Nichts.ÔÇť Sp├Ąter hat J├╝nger st├Ąrker die Essenz des dandyistischen Daseinsentwurfs gesehen, wenn er am 3. Februar 1983 in sein Tagebuch eintr├Ągt: ÔÇ×Zur Selbstkritik. Den Dandy kr├Ąnkt mehr, wenn er ├Ąsthetisch, als wenn er moralisch nicht gen├╝gt. Die Unversch├Ąmtheit, falls sie gut placiert ist, schafft ihm den n├Âtigen Respekt im Umgang mit Leuten, die ihm durch eine geschmacklose Krawatte mi├čfallen, wie Brummell sie an Georg IV. r├╝gt.
Dorian Gray vernichtet sein Bildnis nicht seiner Untaten wegen, sondern weil es h├Ą├člich geworden ist. Die Blutflecke darauf werden gr├Â├čer und bedecken nun auch die Hand, die das Messer gef├╝hrt hat ÔÇô das qu├Ąlt ihn, weil die Haut runzlig geworden ist.
Dazu Wilde: ÔÇÜNicht der Mord, sondern sein Bild hatte die Rolle des Gewissens ├╝bernommen; es hatte die Sch├Ânheit verloren, darum zerst├Ârte er es ÔÇô er l├Âschte sich aus.ÔÇÖÔÇť
IN SEINEM BEHARRUNGSVERM├ľGEN. Besa├č er doch die Cruzpe, die brav-biedere Bundesrepublik fast bis zum 103. Lebensjahr allein mit seinem Dasein zu ├Ąrgern.
Einige Monate vor dem 10. Todestag Ernst J├╝ngers brachte der Siedler Verlag, der zur US-amerikanischen Random House-Gruppe geh├Ârt, die erste Biographie ├╝ber diesen Doyen des deutschen 20. Jahrhunderts heraus. Der Literaturprofessor Helmuth Kiesel war kurz vor Heimo Schwilk fertig, der seine Biographie wenig sp├Ąter bei Piper ver├Âffentlichte.
Dies Haus als Heimstatt des Buches ist nicht ganz unpassend, f├Ąllt der Name des Verlagsgr├╝nders und von dessen Vater doch darin. J├╝nger hatte mit Siedler sen. seinen Sohn und den mit ihm befreundeten Wolf Jobst Siedler 1943 im Gef├Ąngnis besucht. Sie sa├čen ein, weil sich Ernst J├╝nger jun. despektierlich ├╝ber das Naziregime ge├Ąu├čert hatte und denunziert worden war.
Dass Kiesel J├╝nger verehrt, wurde dem gr├Â├čeren Publikum bereits 1995 bekannt, als er an seiner Universit├Ąt Heidelberg einen Festakt aus Anlass von J├╝ngers 100. Geburtstag ausrichtete. Kiesels hier gehaltene Rede nahm den Duktus seiner monumentalen Biographie vorweg: Der professorale Biograph ist doch sehr bem├╝ht, einer l├Ąngst zuende gegangenen political correctness zu gen├╝gen, indem er immer wieder Vorw├╝rfe gegen J├╝nger aufnimmt, um diese dann zu bestreiten. Gern w├╝rde man schreiben, zu entkr├Ąften, doch das tut Kiesel nicht.
Dennoch ist Kiesels allein vom Umfang beachtliches Werk eine ├Ąu├čerst lesenswerte Biographie. Zwar will ihm der sprachliche Tonfall einer anziehenden Erz├Ąhlung nicht recht gelingen. Die Materialf├╝lle und das Vermeiden von voreiligen und flachen Wertungen sprechen dagegen f├╝r das Buch. Der Leser bekommt einen Eindruck vom Leben dieses Ernst J├╝nger wie kaum zuvor. Kiesel hat seine Auswertung der verschiedenen, immerhin sechs Fassungen der Stahlgewitter noch erg├Ąnzt durch eine Einbeziehung der Originalaufzeichnungen. Hierdurch ergibt sich ein noch treffenderes Bild ├╝ber J├╝ngers damalige Wahrnehmung und die sp├Ąteren Stilisierungen. Dies hat allerdings auch eine kritische Seite: Man h├Ątte sich an vielen wichtigen Stationen in J├╝ngers Leben ein wenig Mehr an Schilderungen seines Lebens und seines Alltags gew├╝nscht. Stattdessen merkt man dem Biographen seine Herkunft als Literaturwissenschaftler an. Immer wieder zieht sich Kiesel in sekund├Ąre Nacherz├Ąhlungen des von J├╝nger selbst beschriebenen und publizierten Erlebten zur├╝ck. F├╝r den, der J├╝ngers Werk bereits kennt, ein wenig erm├╝dend.
Erfrischend dagegen lesen sich S├Ątze wie: ÔÇ×In den siebziger und achtziger Jahren konnte im akademischen Bereich ├╝ber J├╝nger nur ÔÇÜkritischÔÇÖ gesprochen werden; eine Besch├Ąftigung mit seinem Werk bedurfte der Legitimation, und eine Publikation ├╝ber ihn mu├čte mit salvierenden Erkl├Ąrungen beginnen.ÔÇť
Die B├╝hne ist abger├Ąumt, die Front ist bereinigt. Nun k├Ânnen wir uns mit dem geistigen J├╝nger besch├Ąftigen.
geschrieben am 15.04.2008 | 795 Wörter | 4842 Zeichen









Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergńnzungen