Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern

Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Friedrich Georg Jünger âÄ™ Werk und Leben
| ISBN | 3854181213 | |
| Autor | Andreas Geyer | |
| Verlag | Karolinger Verlag | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 320 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | gebundene Ausgabe |
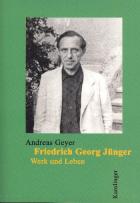
Rezension von
Jan Robert Weber
Im Herbst 2007 ist im Schatten der beiden Biographien ΟΦber Ernst JΟΦnger nun auch eine Studie zu Werk und Leben von dessen Bruder Friedrich Georg JΟΦnger erschienen, die Andreas Geyer geschrieben hat. Geyers Werkbiographie kommt anlΟΛsslich des 30. Todesjahrs des Dichters heraus und ist, so der Verfasser, auf eine Anregung Ernst JΟΦngers aus dem Jahr 1995 entstanden. Geyer will sein Buch als βÄûEinladungβÄ€ an die Ο•ffentlichkeit verstanden wissen, sich mit dem vergessenen Dichter zukΟΦnftig zu beschΟΛftigen. Es gilt also, einen heute wie auch zu Lebzeiten zumeist unbekannten Dichter aus den Untiefen der Vergessenheit zu bergen. TatsΟΛchlich hat Geyer eine fundierte, kenntnisreiche und verstΟΛndige Werkbiographie verfasst, die dem Leser den βÄökleinen BruderβÄô Ernst JΟΦngers ohne ΟΦbertriebene Rettungsversuche vorstellt.
weitere Rezensionen von Jan Robert Weber

Deutlich wird, dass die Leben beider BrΟΦder in weiten Strecken parallel liefen, zumal in der geistig-literarischen Entwicklung, wenn auch Friedrich Georg JΟΦnger bald einen eigenstΟΛndigen Ton fand und sich anderer ΟΛsthetischer Mittel bediente als sein βÄögroΟüer BruderβÄô. Nach Kriegsverwundung und Jura-Studium kam Friedrich Georg JΟΦnger in das nationalistische Fahrwasser der Konservativen RevolutionΟΛre und vertrat dabei ΟΛhnlich radikale und demokratiefeindliche Positionen wie sein ΟΛlterer Bruder Ernst. Das Jahr 1933 bedeutete auch fΟΦr ihn keines der ErfΟΦllung politischer TrΟΛume, sondern eines des Unheils. Hitlers NS-Staat erschien ihm als Fortsetzung der Demokratie mit tyrannischen Mitteln: βÄûSchmerzend hallt in den Ohren der LΟΛrm mirβÄ€, dichtete er fΟΦr Niekischs oppositionelle Zeitschrift βÄûWiderstandβÄ€ mutig gegen die allgemeine Begeisterung in der BevΟΕlkerung nach dem Regierungsantritt der braunen Machthaber. In der Inneren Emigration verfasste Friedrich Georg JΟΦnger immer wieder essayistische Schriften und Gedichte, die in verdeckter Schreibweise das NS-Regime anklagten. βÄûKlug bin ich geworden wie die Schlange, // Biegsam, boshaft, munterβÄ€, schreibt er 1937 im Gedicht βÄûAbschiedsliedβÄ€ nicht ohne Selbstbezug. Mitte der 1930er Jahre fand Friedrich Georg JΟΦnger dann auch zu der Weltanschauung, der er bis zu seinem Lebensende anhing: Er wird heidnischer Kykliker, vertritt also die Lehre von der βÄöEwigen WiederkehrβÄô.
Das zyklische Weltbild bildete die Grundlage der Naturverbundenheit und Technikfeindschaft, auf der das Hauptwerk βÄûDie Perfektion der TechnikβÄ€ entstand. Seit den 1940er Jahren bis zu seinem Tod trat der Dichter als βÄûweiser Werber fΟΦr eine ΟΕkologisches WeltverstΟΛndnisβÄ€ auf, so Geyer, und legte damit das argumentative Fundament der spΟΛteren Ο•ko-Bewegung. Technologischem Fortschrittsglauben und rationalistischen Wirtschaftswachstumstheorien erteilte er so auf literarische Weise eine deutliche Absage. Geyer hebt hervor, dass JΟΦngers Zivilisationskritik βÄûfrappierende Parallelen und KomplementaritΟΛtenβÄ€ zur βÄûDialektik der AufklΟΛrungβÄ€ Horkheimers und Adornos aufweise, ohne dass eine bewusste gegenseitige Bezugnahme bestanden haben kann. Offenbar hatten die vor Hitler geflΟΦchteten Vertreter der Kritischen Theorie nach den Kataklysmen des Zweiten Weltkriegs ΟΛhnliche Vorbehalte vor der abendlΟΛndischen Zivilisation wie der im Reich gebliebene konservative Dichter. Die instrumentelle Vernunft des Nazismus war fΟΦr ihn wie auch die beiden Exilanten kein Unfall der Geschichte, weil die AufklΟΛrung den Terror einer repressiven ZweckrationalitΟΛt in sich berge. Als βÄöAhnvaterβÄô wurde JΟΦnger von der linken Ο•ko-Bewegung in den 1970er und 1980er Jahren allerdings nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht offiziell. Zu groΟü waren wohl die BerΟΦhrungsΟΛngste mit dem Konservativen, der obendrein auch noch Ernst JΟΦngers Bruder war.
Andreas Geyer ist die βÄûEinladungβÄ€ gelungen, sich mit Friedrich Georg JΟΦngers Werk und Leben zukΟΦnftig intensiver auseinanderzusetzen. Neben den politisch bedeutsamen Werken βÄ™ den Gedichten aus der NS-Zeit, den ΟΕkologischen Essays der Nachkriegszeit βÄ™ sind es wohl weniger die klassizistischen Gedichte als die ErzΟΛhlungen, die es wert wΟΛren, auch heutzutage ihre Leser zu finden. Im fiktionalen ErzΟΛhlen war Friedrich Georg JΟΦnger nΟΛmlich weitaus besser als sein βÄögroΟüer BruderβÄô Ernst. Zu recht betont Geyer den βÄûenormen FacettenreichtumβÄ€ des JΟΦngerschen ErzΟΛhlwerks, das immer wieder βÄûzu ΟΦberraschenβÄ€, βÄûim besten Sinne zu fesseln und zu unterhaltenβÄ€ vermag. Sollte Friedrich Georg JΟΦnger als ErzΟΛhler tatsΟΛchlich wiederentdeckt werden, so wΟΛre das auch ein Verdienst Geyers, der nicht wenige Novellen des Dichters in seiner Werkbiographie mit kurzen, instruktiven Interpretationen gewΟΦrdigt hat.
geschrieben am 01.01.2008 | 618 Wörter | 4084 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergδnzungen